Auf drei Rädern
durch den Westen
Erzgebirge > Vogtland > Frankenwald >
Main > Neckar > Rhein
Vogesen > Ardennen > Wallonien > Flandern > Eifel
Meine diesjährige Sommertour führt mich nach Belgien - und zurück… Naja, nicht ganz. Aber dazu komme ich später. Viele Wege führen Brüssel - es kommt drauf an, woher man kommt. Mein Reiseetappen, die jenseits bekannter Radfernwege liegen, hat diesmal eine himmlische Beobachterin namens Kommot ![]() aufgezeichnet - selbst jene Winkel, wo ich nur mal kurz um die Ecke geguckt habe, sind ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen... Einerseits bin ich der Frau aus dem Weltall dankbar, dass sie meine Strecken auf den GPS-Meter genau dokmentiert hat - so kann ich noch Wochen nach der Tour nachsehen, welche Wege ich nahm. Andererseits liefere ich auf diese Weise Daten an das Orwellsche Wahrheitsministerium.
aufgezeichnet - selbst jene Winkel, wo ich nur mal kurz um die Ecke geguckt habe, sind ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen... Einerseits bin ich der Frau aus dem Weltall dankbar, dass sie meine Strecken auf den GPS-Meter genau dokmentiert hat - so kann ich noch Wochen nach der Tour nachsehen, welche Wege ich nahm. Andererseits liefere ich auf diese Weise Daten an das Orwellsche Wahrheitsministerium.
Das Ziel meiner Reise ist wie immer der Weg, aber das eigentliche Thema ist Freundschaft - das Besuchen alter Freunde liegt quasi am Wege. Jeder meiner Freunde hat ein paar Noten oder Pausenzeichen in meinem musikalischen Lebenswandel hinterlassen, gemeinsame Kilometer in Pedalen oder auf Schusters Rappen gehören auch dazu. Jede Freundschaft braucht von Zeit zu Zeit neue Begegnungen, sonst verkümmert sie zur Geburtstags- und Neujahrsgratuliererei. Musik ist das Bindeglied zwischen allen und allem - eine musikalische Adresse steht am Ziel meiner Reise.
Ein anderes Thema ist das Mittel zum Zweck - das Transportmittel, das meine Art des Fahrens ermöglicht. Bei dieser Reise werden die Er-fahr-ungen mit meinem Liegedreirad eine Rolle spielen - in technischer Hinsicht eröffnet sich für mich ein neuer Horizont. Vor allem aber ist in einem Liegerad die Sicht in die Welt deutlich tiefer gelegt - mein Kopf befindet sich beim Radeln auf Augenhöhe mit Kindern - und größeren Hunden. Manche der Vierbeiner reagieren aggressiv. Ein junges Pferd hingegen bekam es mit der Angst zu tun und es gallopierte davon, die Reiterin hatte keine Kontrolle. Auf der Landstraße sind meine Augen allerdings manchmal auf Höhe einer LKW-Achse, meine Lunge auf Auspuffhöhe - daran muss ich mich erst gewöhnen.
1. Etappe ![]()
Dresden > Meißen > Frohburg
Eigentlich wollte ich gegen acht in der Spur sein, aber, naja es gibt halt Verzögerungen. Und so lasse ich erst in der zehnten Stunde die Dresdner Altstadt hinter mir. Bis nach Meißen folge ich dem Elbe-Radweg am linken Ufer - für mich nichts neues, doch der Blick auf die Gohliser Windmühle und nach der Kurve zu den Weinbergen zwischen Radebeul und Meißen ist immer aufs neue reizvoll. |
||
Der Radweg gehört mir trotz der Verspätung noch fast allein - die Sonntagsradler sitzen noch beim Frühstück. Unterhalb von Scharfenberg, auf halebn Weg nach Meißen, liegt eine Prise Cowboy-Romantik in der Luft - das Wiehern und Schnaufen der Pferde im Reiterhof des „Western Inn“ klingst auch für einen Pedalritter schon fast wie Musik. Einen Kilometer vor der Meißner Altstadt trifft der Elbe-Radweg die B6 und mein erster Blick fällt auf die mächtige Burg der Porzellanstadt. Mein zweiter Blick fällt auf die große Terrasse einer gastronomischen Einrichtung. Ich meinen Magen knurren, blicke auf die Uhr - und sage mir: Ja, es ist Zeit für einen Mittagsimbiss.
Knapp 10 Kilometer weiter, ab Diera-Zehren, verlasse ich den Elbe-Radweg und nutze ab hier die Komoot-Navigation. Am Ende eines Dorfes erhalte ich die Anweisung, nach links abzubiegen, auf einen Feldweg - die Frau im Weltall bezeichnet solche Wege neudeutsch als „Single Trail“. Doch der Feldweg ist nach einem kurzen Stück zunehmend von Gestrüpp überwuchert - ich muss zurück auf die Landstraße und eine alternative Strecke finden. Da schimpft die Frau, die mich vom Weltall aus überwacht: „Du hast die Tour verlassen, wirf einen Blick auf deine Karte!“
Für einen freien Mann, der eheähnliche Bevormundung nur aus Feldstudien bei mehr oder weniger befreundeten Familien kennt, sind solche Ansagen gewöhnungsbedürftig, aber nach einer Weile nehme ich den resoluten Tonfall meiner himmlischen Begleiterin kaum noch war. Zu einer der ersten Erkenntnisse dieser Reise gehört nun: Gewohnheit ist alles. Man gewöhnt sich an den gedeckten Tisch, an gemachte Betten, gebügelte Hemden, an Schmeicheleien, Belobigungen, Gefälligkeiten, aber ebenso an die verschiedensten Arten von Bevormundung - und offenbar sogar an die Stimme einer Frau, die sagt, wo es langgeht.
Im Dörfchen Piskowitz heißen alle Straßen und Abzweigungen, kreuz wie quer, Dorfstraße. Die Frau aus dem Weltall ist davon unbeeindruckt und navigiert mich zum Eingang eines Betriebes, der sein tristes Erscheinungsbild seit DDR-Zeiten höchstens zu noch mehr Verfall verändert haben dürfte. Wie hieß so was damals doch gleich? Ach, ja: LPG - Landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft. Ich bin verunsichert, fahre in den Hof und kehre beim Anblick von viel Schutt und Schrott um. Hat die Frau im Weltall den Überblick verloren? Da kommt eine irdische Frau, die frage ich. Sie zeigt mir einen Pfad links des Betriebes, der ist von Bäumen beschattet und dann zu beiden Seiten mit Brettern eingezäunt. Werde ich da überhaupt durchkommen?
Auch ein Dreirad kann umkippen
Etwa 85 Zentimeter beträgt der Abstand meiner beiden Vorderräder - in der Rechtskurve wird es sehr eng, aber ich komme durch. Danach wird der ausgetretene Weg noch schmaler, ist aber nur noch auf einer Seite abgezäunt. Doch der als Radweg gekennzeichnete Wanderpfad, mehr ist es eigentlich nicht, steigt an, nicht nur in Fahrtrichtung, sondern auch seitlich. Ich komme zum Stehen, kippe dann nach links gegen den Zaun - und bin !somit im Sitz meiner Sänfte eingeklemmt. Was nun? Nur mit großer Mühe kann ich mich befreien. Erst, als ich wieder frei bin, kommen Passanten, die mir fünf Minuten eher sicher gern geholfen hätten. Bis zu meinem heutigen Etappenziel habe ich noch etwa 80 Kilometer vor mir - weiter geht's.
Ab Döbeln bin ich auf dem Mulde-Radweg - den kenne ich bereits von einer Oster-Tour im Jahre 2015. Damals schickte allerdings der alte Winter in seiner Schwäche ... ohnmächtige Schauer körnigen Eises ... über die grünende Flor… Nach einer beschaulichen, aber schneeglatten Fahrt durchs Freiberger Winterwunderland peitschte mir damals der Hagel dermaßen ins Gesicht, dass ich Goethes Verse nie wieder vergessen werde - es ging nur noch darum, schnell ein schützendes Dach zu finden, mein Quartier kurz vor Leisnig, zu dessen romantischen Namen „La Petite Provence“ damals keinerlei Affinität mehr aufkommen konnte. Für die landschaftlichen Reize der Umgebung war damals also alles zu spät. Doch das hole ich diesmal bei Sommerwetter im schönsten Sonnenschein des Spätnachmittags nach.
Am späten Nachmittag pausiere ich im Hof des einstigen Klosters von Klosterbuch - ein Stück Aprikosenkuchen, das mir eine der beiden Klosterkantinenfrauen verführerisch vor die Nase legt, ist der wohlverdiente Luxus dieser Kaffeepause. |
||
Auf dem Marktplatz des Städtchens Frohburg, das ich bereits von drei Besuchen kenne, treffe ich meinen Freund Jörg, der mir heute Unterkunft und Abendbrot bietet. Meine Sänfte tragen wir hinauf zur Wohnung im Dachgeschoss. Und dass diese Maßnahme mehr als nötig ist, unterstreicht die Tatsache, dass Jörgs eigenes Fahrrad nur eine Woche zuvor gestohlen wurde - Sonntagmorgen um 9, an der Eingangstür eines Hauses am Marktplatz einer Kleinstadt, die so weit weg von den kriminellen Brennpunkten der Republik zu liegen scheint… Vielleicht ist die Angst vor dem Diebstahl meines Reisegefährtes für übertrieben, aber es war eben ziemlich teuer - ich schließe es selbst im Hausflur der obersten Etage mit zwei fetten Schlössen an. Uund schalte zusätzlich eine versteckte Alarmanlage ein.
2. Etappe ![]()
Frohburg > Crimmitschau > Werdau > Plauen
In der 8. Stunde breche ich auf, das Frühstückspaket verzehre ich in einem Wäldchen vor Altenburg. Die Skat-Stadt streife ich östlich und folge dem Lauf der Pleiße. Auf dem Gipfel eines Hügels pausiere ich im Dörfchen Maltis - ich fahre in einer Sackgasse und befinde mich dort offenbar im Mittelpunkt des Dorfes. Etliche Häuser sind verfallen, andere werden saniert - der Wohlstand ist hier noch lange nicht ausgebrochen. Dennoch oder gerade deshalb wirken die Bewohner entspannt - ein Mann, Mitte 50, spricht mich wegen meines Gefährts an, ein etwas älterer kommt dazu. Dieses Dörfchen, wäre als Wohnsitz ganz nach meinem Geschmack, sage ich, wäre ich für meinen Lebensunterhalt nicht auf mein städtisches Publikum angewiesen. Der Alte antwortet, er hätte noch ein kleines Häuschen übrig, das könne ich mir gern ansehen…
Mittags erreich Görnitz - nur wenige Passanten queren den Fußgängerboulevard des Städtchens, Auf dem Schild eines kleinen Restaurants wird Nudelsuppe feilgeboten. Das bestelle ich mir und dazu eine Tasse Kaffee - als Nachtisch noch zwei Kugeln Eis. Beim Essen lausche ich den Liedern eines jungen Straßenmusikers - er singt auf englisch und begleitet sich auf der Gitarre, aber keines der Lieder ist mir bekannt. Nachher unterhalte ich mich kurz mit ihm - er kommt aus Norwegen, ist mit einem Wohnmobil unterwegs, reist auf diese Weise durch Europa. Eine Frau, die die elektrisch verstärkte Beschallung noch kritisch kommentierte, als sie am Tresen des Restaurants stand, kommt dazu und fragt den jungen Mann, ob er nicht mal „was Bekanntes“ spielen könne? - Der Norweger versteht sie erst, als sie „zum Beispiel was von ABBA“ ergänzt. Nach zwei Takten erkenne ich den 70er-Jahre-Hit „Dancing Queen“, beim Refrain ist auch die Frau hellauf begeistert - und sucht nach Kleingeld, das sie dann in den Gitarrenkoffer legt.
Kleingeld brauche ich in einem Supermarkt in Crimmitschau, wo ich weiter nichts als zwei Aprikosen zu Kasse trage. Eine alte Frau, die in der Schlange vor mir steht, will mich vorlassen, sonst seien die beiden Aprikosen nachher nicht mehr frisch, ergänzt ihr Mann. Ich bedanke mich - mit der schelmischen Behauptung, dass ihnen mein Pferd, das draußen vor der Tür schon mit dem Hufen scharre, ebenso dankbar sein wird. Hoffentlich steht es noch da, erwidert der alte Mann. Ja, das kann ich nur hoffen, antworte ich, denn heutzutage weiß man ja nie… Und das wird noch schlimmer, ergänzt die alte Frau.
Da sage noch einer, auf dem Lande gäbe es keine kecken Sehenswürdigkeiten... Ich weiß nicht, wie derzeitig die Nachfrage nach Insekten ist, das Angebot ist jedenfalls da. Für eine ausgiebige Nähnadelsruhe hingegen habe ich selbst immer großen Bedarf - schwer vorstellbar, dass man die gerade in einer Gartenanlage finden soll, aber vielleicht herrscht hier ja die eine große Ausnahme, nach der die Geminschaftsanlage benannt ist.
In Werdau suche ich ein Lädchen, wo ich Wasser für die Fahrt und Wein für den Abend kaufen könnte. Stattdessen finde ich einen Trödelladen, wo es alles Mögliche vom kitschigsten Reisesouvenir bis zu nützlichen Kleinutensilien wie Koffergurte gibt - genau einen solchen, mit dem ich das Zelt auf meinen Gepäcktaschen befestigt habe, muss ich wegen einer defekten Schnall ersetzen. Mein Kleingeld reicht nicht mehr - ich muss einen der grünen Scheine hervorziehen, die eigentlich zum Zahlen der Übernachtungen in abgelegenen Dörfern vorgesehen sind.
Nach dem beschaulichen Städtchen verlasse ich die Pleiße, die mir in den Stunden zwischen Altenburg und Werdau immer mal wieder etwas vorplätscherte. Die nächste Stadt kenne ich bereits von einem früheren Besuch. Lebte ich nicht seit bald zwei Jahrzehnten am Sterbeort jener Schauspielerin, welche die Volksbelustigung des deutschen Jahrmarktes durch shakespearschen Tiefgang ersetzen wollte, wüsste ich wahrscheinlich nicht, dass Reichenbach der Geburtsort jener Caroline Neuber ist, die als Neuberin in die deutsche Theatergeschichte einging. Aus ihrem Munde zitiert die Webseite des Reichenbacher Museums: "Das Glücksrad ist ein Ding von unsichtbarer Größe - dem einen hilft es fort, dem andern gibt es Stöße.“ - Gut gereimt, aber nicht ganz zu Ende gedacht. Heute zeigt das Glücksrad auf dich, morgen ist ihm dein Glück egal.
Wie dem auch sei: Möge mir auch mein neues Fahrrad helfen fortzukommen - möglichst ohne Stöße. Bisher ging es nur über moderate Hügel, doch der Berg am Mühlwald hat es in sich - zwischen 200 und 450 Metern über Meeresspiegel geht es auf und ab, überwiegend aufwärts. Nach stillen waldigen Abschnitten gelange ich in der sechsten Stunde an die Talsperre Pohl, die ein beliebtes Ausflugsziel ist - Segelboote und kleine Schiffe kreuzen über das Blau des künstlichen Gewässers, doch an diesem Montagabend ist der Andrang schon vorbei. Die Terrasse eines kleinen Restaurants lädt zum Verschnaufen bei Bulette, Brot und Bier. Doch zu lange darf ich nicht verweilen, noch liegt Plauen vor mir. Und bis zu meinem Quartier hinter der Stadt sind es noch etwa 15 hügelige Kilometer.
Ich passiere die Stadt Plauen, die ich dank einer gelegentlich besuchten Bekannten einigermaßen kenne, am Sadtrand und bin nach einem letzten Anstieg nahe meiner heutigen Unterkunft. Die Frau aus dem Weltall sagt: „Du bist gleich am Ziel.“ - Das ist sehr erfreulich. Auch die in Arbeitskluften eintreffenden Polen, die gleich ihren wohlverdienten Feierabend genießen wollen, werden sich freuen. Weniger erfreulich für mich ist, dass der Pensionswirt sich nicht mehr an meine Zimmerbuchung erinnert: „Sind Sie sicher, dass Sie für heute gebucht haben? - Wir sind nämlich ausgebucht.“
Alexander, bleib jetzt ganz ruhig… Irgendeine pazifistische Lösung für dieses Problem muss es geben. Ich zücke mein Phone, klicke in die Emails und suche diejenige aus, welche meine Buchung bestätigt. Denn extra für einen solchen (bisher nie eingetretenen) Fall habe ich um eine Bestätigung meiner Buchung gebeten. Ich lese dem Pensionsbetreiber also seine Bestätigung vor: „Gern bestätige ich ihre Anfrage und reserviere ein Zimmer für Sie. Wenn Sie diese E-mail bestätigen ist die Bestellung perfekt.“ Auch der Wirt bittet also um eine Bestätigung - das ist legitim. Ich lese ihm auch diese meine Gegenbestätigung vor: „Ich freue mich, dass es klappt, und bestätige hiermit meine unerschütterliche Buchungsabsicht.“
Wollen Sie erstmal ein Bier?, fragt mich der Mann jetzt. Nein, antworte ich: Ich bin müde und das einzige, was ich will, ist ein Platz zum Schlafen! - Der Mann scheint zu begreifen, dass ich an dieser Stelle des Tages keine Späßchen verstehe. Daraufhin verspricht er, in benachbarten Pensionen nach freien Zimmer anzurufen - und lässt mich draußen stehen. Nach einer unendlich langen Viertelstunde kommt er heraus und erklärt, er habe etwas gefunden, gleich im nächsten Ort. Die Adresse hat er nicht, aber wie gesagt, das sei ja gleich im nächsten Dorf, hinter dem Teich: dort links abbiegen, dann rechts… Kann ich jemand trauen, der das ursprünglich für mich reservierte Zimmer einfach an andere Gäste vergibt, wenn es ihm mehr bringt?
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Ich mache mich auf den Weg - und verspreche mir, dass der Abend für diesen Mann genauso ungemütlich ausgehen muss wie für mich, falls da noch was schieflaufen sollte. Eine Viertelstunde später erreiche ich das Dörfchen Thiergarten - und ich bin sofort von seiner Idylle angetan. Ein glücklicher Zufall will es, dass ich ohne Angabe einer genauen Adresse plötzlich direkt vor der gesuchten „Pension Sabine“ stehe. Die Wirtin begrüßt mich freundlich - und verrät mir bald auch, dass ich nicht der erste Gast sei, der auf diesem Weg bei ihr ankomme. Der Verdacht liegt nahe, dass der Wirt der anderen Pension sich nur dummstellte - um das lukrativere Geschäft zu machen, das eine ganze Brigade, länger bleibender Gastarbeiter verspricht. Das lässt sich nicht beweisen, gebe ich zu bedenken, aber meine neuen Gastgeber sind sich da sicher.
Das Zimmer ist vorzüglich und die abendliche Ruhe im Dorf ist so angenehm, dass ich gern noch ein bisschen im Hof sitze. Ich spiele der Enkelin der Pensionswirtin ein Lied auf meiner Ukulele vor, aber die Kleine ist sehr schüchtern - eine Zugabe ist nicht nötig. Ich schließe mein Rad im Garten an und weise die Wirtsleute daraufhin, dass ich auch eine Alarmanlage einschalte und dass diese bei leichter Bewegung am Rad auslöst. Ja, die Zeiten haben sich geändert, man könne jetzt auch hier nichts mehr unverschlossen lassen. Eines Tages hätten bereits Türken in die Scheune gestanden, die müssen vorher über etliche Zäune aufs Grundstück gekommen sein. Seit dem ist man misstrauisch. Vielleicht waren die Türken auch Tschechen, das wäre eigentlich naheliegender. Vielleicht haben sie sich beim Verabschieden nr als Türken ausgegeben. Sicher ist: Auch das idyllischste Dörfchen im stillsten Tälchen ist nicht mehr sicher vor ungebetenen Gästen.
Den Rest des Abends verbringe ich mit zwei schweigsamen Fußballfans... Eigentlich dachte ich, der WM-Rummel hätte sich in deutschen Landen längst erledigt. Die deutsche Elf ist schon in der Vorrunde rausgeflogen. Aber die Fan-Artikel sind produziert. Sie liegen, sie sitzen, sie stehen herum. Als ewiger Misionar im Dienste der Ukulele zeige ich selbst im Urlaub noch den Weg auf den Pfad der wahren Hochkultur.
|
3. Etappe ![]()
Plauen (Vogtland) > Michelau (Oberfranken)
Im idyllischen Thiergarten südlich von Plauen gibt es weder WLAN noch Mobilnetz. Das Dörfchen liegt sowas von im Funkloch, dass mein Handy keine Verbindung ins Internet herstellen kann. Damit kann ich auch nicht die Frau im Weltall kontaktieren, die mir sagt, wo lang es geht. Die ersten Kilometer fahre ich daher nach Sonne, Mond und Sternen - gut, letztere sind an diesem strahlend blauen Dienstagmorgen nicht zu sehen, also muss auch mein Bauchgefühl einspringen.
Dass das Laden der Offline-Karten ohnehin nicht erst unterwegs über das schwache Mobilnetz erfolgen sollte, hätte mir die Frau aus dem Weltall auch mal sagen können. Ich war doch tatsächlich so naiv zu glauben, ich hätte mit dem Erwerb aller käuflichen Zusatzfunktionen auch gleich die Offline-Karten der ganzen Welt im Handy - im WLAN-Bereich zuhause sah das so aus. Unterwegs bemerke ich nun auch, dass mein auf ein GB limitiertes Mobilfunk-Budget nach zwei Reisetagen zur Hälfte verbraucht ist. Um so wichtiger ist es jetzt, Notizen zu machen. Ich greife an die linke Schenkeltasche meiner Cargo-Hose, wo ich üblicherweise mein Tagebuch aufbewahrt habe. Doch die Tasche ist leer, der Klettverschluss geöffnet. Ich drehe um, fahre etwa einen Kilometer zurück. Und siehe da: Manchmal zeigt das Glücksrad der Neuberin auf mich - das kleine schwarze Büchlein liegt samt Kuli auf der Straße, wo es aus meiner Tasche gerutscht ist. Der Tag ist noch jung, aber die Lektion, dass die Schenkeltaschen von Cargo-Hosen beim Liegeradeln besondere Aufmerksamkeit erfordern, ist vielleicht schon die wichtigste des Tages.
In Mödlareuth erinnert ein weiß getünchter Grenzturm an die historische Teilung Deutschlands - eine große Schulklasse wird durch das Freiluft-Museum mit Mauer und Stacheldrat geführt. Ob die Jugendlichen wirklich begreifen können, dass hier bis vor einem halben Menschenleben noch zwei Welten voneinander getrennt waren? Dass Mauer und Stacheldraht nicht nur so herumstanden, sondern - bewacht von Soldaten mit geladenen MGs - eine tödliche Barriere darstellten? Und dass nur weil geist- und skrupellose unktionäre die Dreistigkeit besaßen, die in ihrem Machtgebiet lebende Bevölkerung quasi als Leibeigene zu halten. Wahrscheinlich sind die historischen Verwirrungen für die Jugendlichen von heute einfach nur etwas „von ganz früher“… In jedem Fall ist eine Geschichtsstunde im Freien an einem warmen, sonnigen Vormittag leichter zu verschmerzen als das Pauken im Physik- oder Chemiekabinett.
Urwald. Nein, danke! Es folgt eine Lektion gelebte Demokratie - auf einer Obstplantage wird gegen die Planung eines Nationalparks protestiert, weil man die Rückkehr des Urwaldes befürchtet. Auf einem weiteren Aushang fordern die Freunde des Verbrennungsmotors Brücken, um schneller über die Täler des Frankenwaldes knattern zu können. Auch die Gegner positionieren sich. Gegen die automibilisierte Mehrheit aber werden die Naturfreunde nicht ankommen. |
Den größten Teil der heutige Etappe geht es durch Berge und Täler. Zwischen Gipfeln von 500 und 700 Metern gibt es im Frankenwald einiges an Auf und Ab zu bewältigen. Der schwerste Anstieg liegt nach einem Kaff mit dem Namen Hölle hinter mir. Dann rolle ich ins Tal und folge dem Lauf der Rodach, die kurz vor meinem Etappenziel in den Main mündet. Am Rudufersee lockt ein Strandbad zum Sprung ins kühle Nass, doch nach einigem Abwägen ist mir der baldige Sprung unter die Hoteldusche doch lieber. Um sieben erreiche ich Michelau und beziehe im Gasthaus Goldene Krone mein Quartier. Im Biergarten des Hotels gibt es den halben Liter Huppendorfer Vollbier für 2,20 - da kann man auch noch eins über Radlerdurst schlürfen. |
4. Etappe ![]()
Michelau (Oberfranken) > Krautheim > Volkach > Fahr am Main
Gegen neun bin ich in den Pedalen - ich folge dem Main in südwestlicher Richtung bis Zapfendorf, bleibe dann im Hinterland des Flusses, dessen Ufer ich nochmals in Baunach begegne. Von da windet sich der Main südwärts nach Hallstadt, bevor er wieder westwärts schwenkt. Ich kürze über hügeliges Terrain ab und treffe den Main bei Eltmann wieder, wo ich ihn am frühen Nachmittag überquere und seinem Lauf westwärts folge. In Knetzgau verlasse ich den Fluss wieder und fahre quer übers Land.
Pferdemist zu verschenken. Na, das ist doch mal eine richtig originelle Geschenkidee: Allerdings ist in meinem Radlergepäck jeder Winkel verplant - und es würde schwierig, die vergängliche Fracht ohne Kühlsystem durch halb Europa zu radeln. Deshalb schlage ich das Angebot vorläufig aus - falls ich auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommen sollte, kann ich ja nochmal nachfragen...
Einige Kilometer vor Volkach passiere ich das Dorf Krautheim, ich folge den Anweisungen meiner himmlischen Aufseherin und biege links auf einen Feldweg ab, dann rechts. Auf einer Bank vor einem Wäldchen sitzt ein alter Mann, sein Fahrrad lehnt hinter ihm an einem Baum, er blickt in den Abend. Mein seltsames Gefährt hat er schon aus der Ferne wahrgenommen und so schaut er mir entgegen, als ich mich nähere. Ich halte an, ihn zu grüßen. Er fragt, wohin es gehe, woher ich käme. Woher er selbst stammt, beantwortet er mit einem Heimatlied.
Kein schöner Land
Der alte Mann kann singen, wie jemand, der es sein Leben lang tat. Ohne zu Zögern greife ich meine Ukulele, prüfe kurz die Stimmung und singe - ohne Ansage: Kein schöner Land in dieser Zeit… Sofort stimmt der Alte ein: Als hier das unsre weit und breit… Mal fehlt mir eine Strophe nicht ein, dann weiß er den Anfang und mir fällt der Rest wieder ein, mal ist es umgekehrt: Wo wir uns finden - wohl unter Linden zur Abendzeit.
Der Mann kann singen, wie jemand, der es sein Leben lang tat. Ohne zu Zögern greife ich meine Ukulele, prüfe kurz die Stimmung und singe - ohne Ansage: Kein schöner Land in dieser Zeit… Sofort stimmt der Alte ein: Als hier das unsre weit und breit… Mal fehlt mir eine Strophe nicht ein, dann weiß er den Anfang und mir fällt der Rest wieder ein, mal ist es umgekehrt: Wo wir uns finden - wohl unter Linden zur Abendzeit.
Dann erzählt er mir freudig, dass er 80 Jahre alt ist und dass er der älteste Mann von Krautheim sei, außerdem dass er die Bank, auf der er sitzt, gestiftet habe - und noch zwei andere. Im nächsten Jahr solle ich etwas eher kommen, so Ende Mai, Anfang Juni, schlägt er vor. Da seien die von ihm im Wäldchen gepflanzten Kirschbäume für die Ernte reif, es seien die süßesten im ganzen Land. Als ich mich von ihm verabschiede, sagt er voller Rührung: Ich komme fast jeden Tag zu dieser Bank. Ich habe noch nie erlebt, dass ein fremder Wandersmann anhält und mit mir singt.
Die Stadt Volkach, die ich dann durchquere, ist das Gegenprogramm zu der beschaulichen Episode: Feierabendverkehr, Einkaufszeit, viele Menschen - junge Männer in schicken Autos, Frauen mit schicken Kopftüchern, einige ganz verhüllt… Vor einer halben Stunde verweilte in einer romantischen Liederwelt - schlagartig bin ich zurück in der lärmenden Wirklichkeit des Jahres 2018.
Gegen sieben erreiche ich nach gut 100 Kilometern meine Herberge im Dörfchen Fahr am Main. Ich habe eine musikalische Verabredung. Wie im Jahr zuvor treffe ich mich mit Frau und Herrn Pfeifer von der Firma Kollitz aus Kitzingen, die unter Liebhabern der Ukulele weltweit bekannt geworden ist. Seit zwei Jahrzehnten spiele ich Ukulelen der Marke Brüko, das kleine Instrument hat meinen musikalischen Lebenswandel seither wie kein anderes Instrument geprägt. Nach kurzer Vorstellung meines neuen Fahrzeuges geht es wie im Vorjahr, auf die Vogelsburg, wo wir über Ukulelen reden, was sonst, aber auch über Bocksbeutel,
Bocksbeutelei
Das gläsernes Behältnis namens Bocsbeutel ist im frankischen Weinbaugebiet jedem bekannt, der nicht mehr an der Mutterbrust trinkt. Aber warum heißt die Flasche Beutel und was hat der Bock damit zu tun? Etymologen favorisieren das niederdeutsche Booksbüdel, das für Bücherbeutel steht. Seit der Vorreformationszeit, so lese ich in der Wikipedia, sei für Gebets- und Gesangsbücher ein "beutelartiger Überzug" in Verwendung gewesen. Ein derartiger Bücherbeutel habe auch zum Assecoire von Ratsherren gehört. "Nachdem dies aus der Mode gekommen war, manche aber noch daran festhielten, bezeichnete man die altväterliche Denkart und das Beharren auf einem überwundenen Standpunkt als Bocksbeutelei." - Wie mir scheint, ist derartige Bocksbeutelei bei Ratsherren heute kaum noch üblich, dafür um so mehr bei Ratsherrinnen...
Nach anderen Quellen sei der Begriff auf den "Hodensack eines Ziegenbocks" zurückzuführen. Für diese Deutung spräche angeblich, "dass es Bokesbudel schon im früheren Mittelalter gab, als man noch gar keine Gesangsbücher hatte." Die Redensart "jemandem einen Bocksbeutel anhängen", um ihn lächerlich zu machen, muss nicht näher erläutert werden - zumal die allgemeine Lust der Demütigung das Mittelalter in bester Verfassung überstanden hat. Derartige Bokesbudel dürften dann eher nicht als Behältnis für Geistiges oder Geistliches gedient haben.
Wie dem auch gewesen sei: Beim Blick über den im Abendlicht glitzernden Main, der in weitem Bogen durchs Tal mäandert, mundet ein Schoppen fränkischer Wein, sei er aus Beuteln, Schläuchen, Fässern, Krügen oder aus gewöhnlichen Flaschen eingeschenkt, besonders gut. Vielleicht waren’s auch zwei.
5. Etappe ![]()
Fahr > Kitzingen > Ochsenfurt > Bad Mergentheim > Altkrautheim
Beim Bezahlen meines Zimmers bemerke ich, dass mir ein Bündel Bares vermisse, das ich in einem schwer zugänglichen Innenfach meines Portemonnaies wähnte. Ich suche mein Gepäck drei- und viermal durch - ohne Erfolg. Wo kann ich das verloren haben? Irgendwo bei einer anderen Bezahlerei muss es mir abhanden gekommen sein. Die Sucherei hält mich eine knappe Stunde auf - es war ein signifikantes Sümmchen, da schaunt man schon mal ein Weilchen, bis man aufgibt. Erst um neun komme ich los.
Die Frau aus dem Weltall schickt mich zu Fähre, doch sie weiß nicht, dass selbige nicht fährt. Also muss ich umkehren. Der Weg am linken Main-Ufer ist teilweise geschottert und die Beschilderung lässt auch zu wünschen übrig. Das hält zusätzlich auf.
Ab Kitzingen ist der Weg asphaltiert. Einen Abstecher zur Ukulelen-Schmiede kann ich mir nach der Verzögerung verkneifen. Den Main-Radweg in Richtung Würzburg kenne ich bereits vom Vorjahr, da komme ich gut ohne himmlische Anweisungen aus. Ich schalte meine Reiseleiterin stumm - und lausche nur noch meinen eigenen Gedanken. Aber die drehen sich ums liebe Geld - die ganze Zeit grüble ich über den unerklärlichen Verlust der grünen Scheinchen nach. Bei Marktbreit erinnere mich an das kleine italienische Eiscafé in der Altstadt - und an den Namen eines Arztes, der hier geboren und später allerorten berühmt wurde, in dem er der altersbedingten Zerstreuungslust seinen Namen vererbt hatte - wie hieß er noch gleich? Ach ja, Altzheimer, Alois. Er könnte mich lehren, dass alles vergänglich und somit auch vergesslich ist - und das Geld sowieso.
Was keiner für möglich gehalten hätte
An einer kleinen Bar auf halben Wege nach Ochsfurt kommt mir der Gedanke, dass mir ein kleines Bier beim Vergessen helfen könnte. Gedacht, bestellt. Ich habe noch den Notgroschen, den mir eine Schülerin beim Abschied als Lesezeichen in einem Miniaturbüchlein versteckt hat. Darin suche ich bei der Gelegenheit nach einer tröstlichen Weisheit... "Was keiner für möglich gehalten hat, das tut Gott vor unseren Augen", steht da geschrieben.
Während ich am Tischlein vor der Bar sitze und über den tieferen Sinn des Psalms sinniere, kommt eine Lieferung für das Lokal. Der Fahrer des LKW rangiert hin und her, fährt wieder an und rollt auf meine neben mir geparkte Sänfte zu. Ich springe auf und rufe laut „Heeeee“! Da bremst der Fahrer, ein Mann ostasiatischer Herkunft, und kommt einen Fuß vor meinem Rad zum Stehen - und tut als hätte er alles unter Kontrolle gehabt.
Jetzt habe ich den Vers verstanden: Was keiner für möglich gehalten hat, das tut Gott vor unseren Augen. Diesmal mit Happy End.
In Ochsenfurt muss ich gleich noch einmal einkehren - den Schreck verdauen und nach was Verdaulichem schauen. Auf der Straße vor dem "Purzel", wo ich schon voriges Jahr das beschauliche Straßenleben der Altstadt beäugen konnte, setze ich mich auf exakt den selben Platz. Ich bin nun südlich jenes Äquators, der Deutschland in einen veganen Norden und einen wurstigen Süden teilt - ein Porzellantopf mit heißem Wasser, in dem zwei hellgraue Würstchen schwimmen, in Kombination mit einer Brezen, andernorts Brezel genannt, und einem Weizenbier heißt hier „Weißwurstfrühstück“. Es gibt Traditionen, aber manchmal klafft zwischen Angebot und Nachfrage eine Lücke - die „Nonnenfürzchen“, die hier voriges Jahr angeboten wurden, sehe ich jedenfalls nicht mehr angeschrieben - wahrscheinlich trifft eine Portion fromme Darmluft auch nicht jedermanns Geschmack.
 | Seinesgleichen sucht in jedem Fall die Toilette des kleinen Restaurants - hier kann der ökologisch bewusste Mann zum Umweltschutz beitragen, indem er verdaute "bierhaltige" und "weinhaltige Getränke" ins jeweils dafür vorgesehene Pissoir pinkelt… Nach Ochsenfurt verlasse ich den Main und es geht teils steil bergan - herrlich durch den Wald, entlang einer einstigen Bahnstrecke namens Gaubahn, die nach ihrer Stilllegung zum Radweg ausgebaut wurde. In Igersheim bin ich wieder im Tal, quere in Bad Mergentheim eine alte Bekannte namens Tauber - der Fluss wie das Städtchen lag mir bereits im Vorjahr auf dem Wege. |
Nach Stuppach geht es nochmals steil bergan, ab Rengershausen talwärts, dann am Ufer der Jagst bis nach Altkrautheim. Bereits am Nachmittag versammelten sich Regenwolken - kaum bin ich bei meinem Quartier und habe alles im Zimmer, ergießen sich die Himmelsfluten - eine abendliche Runde durchs Dorf kann ich jetzt vergessen. Die Pensionswirtin hat dafür gesorgt, dass dennoch keine Zunge trocken bleiben muss - Bier, Wein und Wasser stehen zur Selbstbedienung bereit. Die Entsorgung erfolgt jedoch unsortiert.
6. Etappe ![]()
Altkrautheim > Neckarsulm > Eppingen > Bretten > Walzbachtal
Es hat die ganze Nacht geregnet, beim Frühstück nieselt es noch etwas. Nebel steigt aus dem Tal herauf - ich vertraue der Wetter-App und lasse die Regenkleidung verpackt. Auch wenn die Wege noch nass sind, die Wetter-App behält recht, der Nebel lichtet sich und bald wird die Sonne mein Begleiter. |
Wenn ein Satz mit dem Wort "Wir" beginnt, sollte man immer vorsichtig sein. Seit Mark Twain das Tagebuch von Adam und Eva veröffentlichte, könnte jeder wissen, woher das Wort "Wir" kommt: "Montag. Dieses neue Geschöpf mit den langen Haaren ist mir sehr im Wege. Es hängt sich immer an mich und läuft mir nach. Das liebe ich nicht, ich bin nicht an Gesellschaft gewöhnt. Ich wünschte, es bliebe bei den anderen Tieren ... Bewölkt heute, Ostwind, wir werden wohl Regen bekommen ... Wir? Woher habe ich das Wort? Jetzt erinnere ich mich, das neue Geschöpf gebraucht es." Da ist wohl was dran: Frag einen betreuten Mann, ob er ein Feuerzeug hat, und seine Betreuerin kommt ihm zuvor: Wir rauchen nicht! Wo ist der gemeinsame Treffpunkt? In Santiago de Compostela? Im Paradies? Im Nirwana? Beim Anblick des gelben Kreuzes, erinnere ich mich einmal mehr daran, wie gezählt die Tage eines jeden Normalsterblichen sind. |  |
Deshalb gilt es, das Innezuhalten kurz zu halten. Dann weiter zu radeln, denn mein nächster Treffpunkt ist noch eine ganze Tagesradelei entfernt. Ich folge dem Flüsschen Jagst bis Bieringen, von da lotst mich die Frau im Weltall einen steilen Berg hinauf. Nach der Abfahrt gelange ich bei Sindringen ans Ufer des Kocher und folge seinem Lauf bis Neuenstadt am Kocher. Meine himmlische Bewacherin dirigiert mich in südwestlicher Richtung an den Neckar. Ich gelange einigermaßen unvorbereitet in eine Großstadt. Wie kann eine Stadt mit einem beschaulich klingenden Namen wie Neckarsulm so viel Verkehr erzeugen! Laut und hektisch geht es zu - und mehr noch. An einer S-Bahn-Haltestelle springen Männer aus einem Transporter und rennen zur ankommenden Bahn - es sieht nach einer Verfolgungsjagd aus. Sirenen heulen, weitere Autos halten, weitere Männer sprinten zum Bahnsteig, an den Gleisen entlang. Es wirkt wie im Krimi - und es ist wohl auch einer, nur in echt.
Wie es aussieht, wird ein Krimineller verfolgt, dem personellen Aufwand nach zu urteilen, wahrscheinlich auch mehrere. Terroristen womöglich? Die Verfolger sind zivil gekleidet, wirken aber professionell, Polizei vermutlich. Was immer hier los ist, es sieht gefährlich aus. Ich habe keine Angst, aber auch keine Schaulust. Meine in den letzen Jahren gestiegene Abscheu gegen Menschenansammlungen jeglicher Art bekommt hier gleich in der ersten großen Stadt, die ich nicht umfahren kann, neue Nahrung. Die mit Heilbronn zusammengewachsene Stadt am Neckar ist so laut, dass ich die himmlischen Anweisungen meiner virtuellen Reiseleiterin nicht verstehen kann - auch nicht mittels der Ohrhörer.
An einer Fußgängerampel frage ich einen Radfahrer nach dem kürzesten Weg aus der Stadt. Der junge Mann ist freundlich, zeigt mir die Richtung, interessiert sich für meine Tour, wünscht mir gute Weiterfahrt. Ich quere den Neckar, quere eine Autobahn, am gegenüber liegenden Ufer ragen zwei riesige Schornsteine und ein Kühlturm in den Himmel - die neben den Bahngleisen aufgeschütteten Kohlenberge lassen auf konventionellen Kraftwerksbetrieb schließen - also ist hier, wenigstens nur Husten zu befürchten… |
An der nächsten Neckarbrücke, in Neckargartach, entkomme ich der urbanen Grausamkeit wieder - meine himmlische Reiseleiterin führt mich westwärts ins Hinterland, am Leinbach entlang nach Leingarten und Schwaigern. Auf dem Weg nach Eppingen lerne ich einen für mich noch unbekannten Fluss kennen, den oder die Elsenz - er ist eine Sie, weiß ich, nach dem ich die schöne Altstadt bestaunen konnte, die der Fluss zerteilt.
Segen ist der Mühe Preis
"Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis." Darüber muss ich nachdenken. Wenn ich zwischen Stadt- und Landeswappen meiner Heimat die Arbeitsmoral meines Standes plakatiere, will ich wahrscheinlich zu den Guten gehören, zu den Fleißigen, zu den Ehrbaren. Könnte man, mal philosophisch betrachtet, nicht auch ohne die bürgerliche Zierde der Arbeit mit persönlicher Zufriedenheit gesegnet sein? Ich kenne nicht wenige, die erkennen durchaus den Vorteil, von alltäglichen Zwängen befreit leben zu können, frei nach dem Motto: Hartz IV, der Tag ist dir.
Was sit so verwerflich daran, faul in den Tag hinein zu leben - sagen zu können: Der Tag ist mein! Ich kann den ganzen lieben Tag lang tun oder lassen, was ich mag - Hinaus gehen, radwandern und radwandeln - nachdenken, sinnieren, Bilder malen, Gedichte lesen, Lieder singen. Wenn sich der Segen auch ohne den Preis der Mühe einstellen kann, dann ist Schillers Hohelied auf tausend fleiß'ge Hände auch nur ein Credo von vielen anderen. Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagen die einen, ist allen Denkens Urgrund, glaube ich.
Es gibt ein Credo zwischen allem - nichts kommt von nichts. Die Wolken am Himmel schweben jedenfalls weiter faul herum, bis sie fett und schwer und grau werden. Auch am heutigen Nachmittag braut sich wieder etwas zusammen. In Bretten treffen mich erste Regentropfen - ich suche Schutz unter dem Sonnenschirm eines der Restaurants, die ihre Tische und Stühle beim Brunnen des alten Marktplatzes verteilt haben. Ein Kellner ruft gleich von weitem: Nur Unterstellen? Oder was trinken? - Was gibt es denn zu trinken, frage ich zurück. Er empfiehlt mir ein heimisches Gebräu: Das trinken hier alle! - Und leben die alle noch noch? - Ja, bisher schon. - Gut, was die anderen nicht umbringt, wird dann wohl mich erst recht stärker machen.
Während ich mich an der Fachwerk-Kulisse erfreue, hört der kurze Schauer auch schon auf. Ich bin nicht das erste Mal hier, aber es ist immer wieder schön, hier auf ein Bier zu verweilen. Mein Gastgeber in Walzbachthal, ein alter Freund aus Dresden, hat mich schon angerufen. Ich antwortete ihm, er habe noch eine Stunde, um seine persönliche Wilkommenskultur mit Wimpelketten und angemessener Kleiderordnung zu vervollkommnen.
Meine himmlische Dirigentin leitet mich zuverlässig ans Ziel. Auf der Dachterrasse seines neuen Hausanbaus erkenne ich meinen alten Freund Matthi - er scheint meine Ankunft mit der Videokamera zu filmen. Durch den Anbau ist die Einfahrt in den kleinen Hof eng, aber - kann sein, ich wiederhole mich - ein alter Busfahrer kommt überall durch. Dass die Wimpelketten und andere politisch korrekte Willkommensutensilien tatsächlich zur rechten Zeit aufgetrieben und angebracht werden konnten, spricht für die routinierte Vorbereitung meines Gastgebers.
Heute Abend kann ich mal alles stehen und liegen lassen - und irgnedwo steht geschrieben: Sechs Tage hindurch magst du deine Waden schinden; am siebenten Tag aber sollst du feiern, damit dein Rad und Sattel ruhe. Also werde ich für einen ganzen Tag mit meinem alten Freund Matthi den Sabatt feiern. Um meine Wäsche kann sich die vollemanzipierte Herrin des Hauses auch in der Nacht zum Sonntag noch kümmern. Ich kann mich daher jetzt direkt dem gedeckten Tisch zuwenden, dem Abendbrot und - daran scheint kein Mangel zu sein - den Abendgetränken.
Sabbat - Schabbat - Schabbes
Ein Ruhetag ist nach sechs Tagen Radelei und über 700 Kilometern in den Pedalen mehr als angemessen. Dass er auf den biblischen Sabbat fällt, ist geplanter Zufall. Orthodoxe Juden würden weder die Kaffeemaschine noch die Waschmaschine anwerfen, schließlich, so ihre Argumentation, müssten andere Glaubensanhänger zur Bereitstellung des elektrischen Stromes dann ihrer Arbeit nachgehen - und das wäre Blasphemie.
Ich nutze den Vormittag, um mein Radel von dem getrockneten Modder zu befreien, der auf manchem Waldweg kleben blieb. Ich kontrolliere, ob die wichtigsten Schrauben fest sitzen, und putze die Rückspiegel. Meine Gastgeber haben auch einiges zu tun. So findet sich auch Gelegenheit, in dem Miniaturbüchlein mit den Psalmen zu blättern, das ich beim Reiseantritt von meiner ältesten Schülerin geschenkt bekam. Warum bekomme ich ein Büchlein mit Psalmen als Reiseliteratur geschenkt?
Manchmal steht auch die Frage nach dem höheren Sinn aller Künste im Raum. Das Wort Psalm ist altgriechischer Herkunft und bedeutet ursprünglich Saitenspiel, im übertragenen Sinne Lied. Die alttestamentarischen Gebete wurden demnach gesungen - wenn auch nicht zu den Saiten einer Ukulele. Auf einer anderen Reise bekam ich ein miniaturisiertes "Neues Testament" geschenkt, auf wieder einer anderen ein kleines Kreuz aus Bastfasern - Gottes Pläne sind unergründlich.
Am späteren Nachmittag spazieren wie beiden alten Freunde zu einem Waldrand, von wo der Blick über Felder und Wiesen fällt. Die Dächer und Türme sind weit weg - wir reden über dies und das, auch über Durst und ab wann man ihn stillen darf. Besser erst nach Sonnenuntergang, damit der liebe Herrgott es nicht sehen kann? Matthi nimmt seinen Rucksack ab und sucht etwas darin - ich habe mich bereits gefragt, was er für eine so kleine Spazierrunde alles mitschleppt. Dann zieht er zwei Flaschen Bier heraus, gut gekühlt.
7. Etappe ![]()
Walzbachtal > Karlsruhe > Wissembourg > Windstein
Beim Frühstück zeigt mir Matti Fotos aus der Bauphase seines auf Stelzen gesetzten Hausanbaus. Erst aus den Detailfotos wird mir deutlich, welche Arbeit das alles gemacht hat. Meine Sachen sind gepackt, ein letzter Blick auf die geplante Wegstrecke beschließt das Abschiedsfrühstück. Die Frau im Weltall glaubt aber offenbar, ich hätte Bock auf eine Spritztour durch Karlsruhe, jedenfalls führt die von ihr vorgeschlagene Route mitten durch die City. Auch wenn Karlsruhe ein gut ausgebautes Netz von Radwegen haben soll, meine himmlische Freundin sollte mich inzwischen besser kennen.
Gemeinsam mit meinen ortskundigen Gastgebern wandeln wir die Vorschläge von Frau Komoot so ab, dass sie mich am südlichen Rand der Großstadt entlang führt. Und siehe: Frau Komoot ist kompromissbereit und unterstützt beim Suchen alternativer Strecken. Die modifizierte Streckenplanung führt mich am Flüsschen Pfinz entlang bis zum Hauptbahnhof am südlichen Rand der Stadt.
Wie an jedem Hauptbahnhof Europas lungern hier Gestalten herum, die man besser nicht nach dem Weg fragen will. Das muss ich dank meiner himmlischen Reiseführerin auch nicht: Bei nächster Gelegenheit gerade aus, sagt sie. Nach dem Bahnhof geleitet Frau Komoot mich am Ufer eines Flüsschens namens Alb entlang - um einige große Straßen des urbanen Speckgürtels von Karlsruhe komme ich leider nicht herum. Dann aber geht es durchs Grüne - und an den Rhein, den ich mittels Fähre nach Neuburg quere.
An einem kleinen Flugplatz nahe der Grenze zu Frankreich starten Freizeitflieger zu ihren sonntäglichen Flugvergnügungen. In dem kleinen Biergarten des Flugplatzes bestelle ich mir elsässische Pizza, besser bekannt als Flammkuchen. Wenige Kilometer weiter geht es über die Grenze und ich erreiche Wissembourg - auch hier bin ich nicht zum ersten Mal. Die Straßencafes sind voller Sonntagsausflügler, protzige Cabrios und Motorräder knattern durch die engen Gassen der Altstadt und verpesten die Luft mit ihren Abgasen. Eigentlich wollte ich hier ein paar Postkarten kaufen, doch ich trete in die Pedale, um der Stadt zu entkommen.
Meine himmliche Freundin dirigiert mich auf die Route de Vosges - durch die nördlichen Vogesen, doch die Stadt fährt mir noch ein ganzes Stück hinterher - Kolonnen von Motorrädern begegnen mir in den Kurven der Landstraßen. Manche Fahrer grüßen mich mit einem Handzeichen. Wahrscheinlich betrachten sie mein ungewöhnliches Gefährt als ebenbürtiges Verkehrsmittel.
Wenn sie wüssten, was ich von ihren lärmenden Feinstaubschleudern halte... Ich grüße dennoch zurück. Mit 20 bin ich selbst durch die Landschaften geknattert, mit einer MZ Trophy 250, durch Ungarn, Rumänien und Bulgarien, bis zur türkischen Grenze - dort sollte damals, 1980, für mich und meinen Sozius die er-fahr-bare Welt zu Ende sein. Ich werde die Geste nie vergessen, die der Grenzsoldat bei Besichtigung meines Kennzeichenschildes zeigte - sie bedeutet einfach nur "Umdrehen!" und wirkte doch so verächtlich, so erniedrigend.
Immer wieder überholen mich Gruppen von Motorrädern, Cabrios und sonstige Sonntagsfahrer - an den Steigungen ist die geballte Ladung Abgase und Lärm besonders schwer zu ertragen. Und dann schaltet plötzlich auch noch mein Hilfsmotor ab - ist ihm zu warm geworden? Ohne Unterstützung mit all meinem Reisegepäck den Berg hinauf ist sehr anstrengend. Und irgendwas anderes klemmt noch zusätzlich. Doch es gibt keinen Randstreifen - ich muss erstmal irgendwie von der stark befahrenen Straße runter. Ich muss absteigen. Ich lasse die hupenden Motorrad-Cliquen vorbei, dann rolle sehr langsam rückwärts bis zu einer kleinen Waldeinfahrt, wo ich nachsehen kann, was das Problem ist.
Hätte, hätte, Fahrradkette
Die bei Liegrädern dreimal so lange Fahrradkette hat sich an der Führungsrolle im Schutzschlauch verklemmt, der sich offenbar gelöst hat. Um die Kette zu befreien, bleibt mir nichts als das beschädigte Schlauchstück abzuschneiden. Wie froh bin ich, dass ich diese Panne reparieren konnte. Dennoch frage ich mich, wie so etwas überhaupt erst passieren kann. Mit schwarzen Fingen kann ich endlich weiter, doch kurz vor dem Berggipfel gibt der Motor wieder auf. Ein Liegdreierad zu schieben ist ein Thema für sich - mit Hilfe einer Wäscheleine gelingt es mir schließlich, das Gefährt zu lenken, etwa so wie man die Zügel eines Pferdes hält.
An einem Rastplatz namens Col de Pigeonnier - zu deutsch: Taubenschlag - ist mit etwa 450 ü.M. die höchste Passage der Nord-Vogesen geschafft - die tiefste Stelle des Tage war am Karlsruher Bahnhof, unter 100 ü.M. Doch das war noch nicht der letzte Anstieg des Tages. In Lembach quere ich das Flüsschen La Sauer. Hier bin ich schon abseits der Harley- und Cabrio-Strecken und das waldreiche Elsass zeigt sich von seinen beschaulichsten Seiten. Nach Langensoulzbach muss ich nochmals 100 Meter uphill, dann downhill nach Jaegerthal, wo es am Ufer des Schwatzbach entlang zu meiner heutigen Unterkunft geht.
Windstein besteht im Wesentlichen aus der Pension, die auch ein beliebtes Ausflugsgasthaus zu sein scheint - auf der noch sonnigen Terrasse sind alle Tische reserviert. Sogar im weniger anziehenden Hof steht ein reservierter Tisch, an dem gleich eine Gruppe deutscher Radler platznimmt, überwiegend Männer mit Rennrädern, einige in bunten Ganzkörperkondomen. Sie bestellen sich Flammkuchen. Letzeres hatte ich heute schon, ich begnüge mich daher mit einem Griechischen Salat. Die Männer haben Karaffen mit Weißwein bestellt - und wie es aussieht scheint ihnen das edle Gesöff sehr zu munden.
 | Die dreibeinige Katze Nachdem ich den ersten Durst mit einem Bier gelöscht habe, bestelle ich mir gleichfalls eine Karaffe edlen Auxerrois. Und ich verstehe nach dem zweiten Schluck, dass die Männer nicht nur ortskundig sind. Als die Radler aufbrechen, dämmert es - für ein Weilchen ist es ruhig im Hof. Eine dreibeinige Katze schleicht umher - ich locke sie flüsternd zu mir. Sie zögert, doch nach zwei, drei prüfenden Minuten zieht sie ihre Runden enger und streift schließlich mein Bein - ich nehme die Einladung zum Streicheln an, das versteht sie wiederum als Einladung auf dem leeren Stuhl an meinem Tisch platz zu nehmen. Ein paar ältere Franzosen, offenbar Stammgäste, sind zum Abendtrunk eingekehrt - einer von Ihnen spricht mich an, um mich von meinem Tischgast zu befreien. Pour quoi, frage ich zurück, die Katze stört mich nicht - im Gegenteil, ich philosophiere gerade mit ihr. |
Der Alte spricht gut deutsch, so wie die meisten älteren Leute im grenznahen Elsass. Er fragt nach meinem Reiseziel, wir plaudern ein wenig. Ich kann meinerseits einige Relikte Schul-Französisch aktivieren - nicht genug für eine gepflegte Konversation, aber zur allgemeinen Erheiterung. Und ich staune immer wieder, in welchen tiefen Gehirnkammern die vor so langer Zeit geübten Sätze auf ihre Gelegenheit lauern. Ich führe sogar ein Miniatur-Wörterbuch mit Drehscheibe zur Konjugation der unregelmäßigen Verben mit mir - ich habe mir nahezu Unmögliches vorgenommen.
Sonstige Einsichten des Tages: 1) Eine Wäscheleine lässt sich zum Liegedreirad-Lenksystem umfunktionieren. 2) Sind die Französisch-Stunden auch noch so lang her, manche Vokabel lässt sich noch parlieren. 3) Auxerrois ist für alte Knaben einen von den schönsten Gaben.
8. Etappe ![]()
Windstein > Montbronn > Saar-Union > Mittersheim > Tarquimpol
Frau Komoot führt mich durch die nördlichen Vogesen, sogar auf lange, wirklich einsame Waldwege, etwa 15 Kilometer durch den Forêt domaniale de Mouterhouse - eine Stunde lang begegne ich keiner Menschenseele. Oft halte ich an und lausche dem Zwitschern in den Ästen, dem Knistern im Gestrüpp des Waldes, dem Summen einer Hummel und anderer Kleinflieger - genau so habe ich mir Urlaub vorgestellt! Im Städtchen Saar-Union bin ich wieder in der Zivilisation angekommen - die letzten Hügel der Vogesen liegen hinter mir, ich quere die Saar. Eine Landstraße und zwei Dörfer weiter gelange ich wieder ins Grüne, durch die Wälder Lothringens.

Auf dem
Canal des Houillières de la Sarre, schippert ein zum Hausboot umgebauter alter Lastkahn von einer Schleuse zur nächsten. Die Passagiere winken mir - ich winke zurück. Diese Art des Reisens scheint einige Anhänger zu haben. Wenn ich den interessierten Blick des jungen Mädchens auf einem der Boote richtig deute, würde es gern mit mir tauschen - und das kann ich sehr gut verstehen. Während ich keinem einzigen Fahhrad begegne, zähle ich in einer Stunde etwa ein Dutzend Hausboote. Im Rückspiegel erkenne ich, dass sich ein PKW nähert - der Fahrer signalisiert wild hupend, dass er den Radweg für sich allein beansprucht. Ich habe nicht die Absicht, mit einem durchgeknallten Macho in Konflikt zu geraten, und ermögliche ihm das Überholen - als Dank bekomme ich den Split ins Gesicht, den seine durchdrehenden Reifen in die Luft schleudern.
"Man muß uns, glaube ich, nie so viel Verachtung zeigen, wie wir verdienen“, schrieb einmal ein französischer Philosoph - wahrscheinlich erlebte er das gleiche wie ich, nur dass die zu seiner Zeit verfügbaren Pferdestärken noch bei weitem nicht reichten, um die kleinen Steine auf dem Weg in gefährliche Geschosse zu verwandeln. Ja, einjeder Mann verdient eine gewisse Verachtung, aber man muss sie eben nicht immer zeigen, nur weil man schnell davon fahren kann und auf diese Weise keine Gegenwehr zu fürchten hat...
Bei Mittersheim verläuft der Kanal samt Radweg westlich des Grand Etang de Mittersheim - der Große Mittersheimer Weiher. Solche flachen Gewässer dienen seit römischen Zeiten als „Lebendbehälter für Tiere“ - als Vivarium. Hier versorgt der See seit fast 100 Jahren auch den Saarkanal mit konstantem Wasserstand - so jedenfalls verstehe ich eine Erläuterung aus der Wikipedia: "Als Speiseweiher für den Saarkanal dient er seit 1920." Segelboote schneiden durchs Gewässer, am anderen Ufer ist eine große Gruppe quietschvergnügter Kinder zu hören - Bademeister wäre definitiv kein Beruf für mich.
Wohnen wie Gott in Frankreich
Um fünf erreiche ich nahe des Dörfchens Tarquimpol das Chateau Alteville, ein Landgut, das an einem kleineren Weiher gegründet wurde. Die alten Römer nannten solche um ein Gehöft entstandenen Landgüter Villare - wovon sich Villa als Wohnsitz der Herrschaft ableitet, aber auch village als Dorf - und schließlich auch ville für Stadt. Alteville bedeutet ursprünlich also soviel wie Altes Dorf. Das Schloss ist eine Erweiterung des 18. Jahrhunderts - die wechselvolle Geschichte zwischen deutscher und französischer Verwaltung scheint das Schloss ohne größere Beschädigung überstanden zu haben.
Mein erster Eindruck beim Betreten des Gehöfts
ist eher distanziert. Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen stehen herum. Eine Radlerin, deren Gepäck wie meines nach Wanderschaft aussieht, begrüßt mich am offenen Eingangstor. Bonjour. Ich vermute, dass sie auf der Suche nach einem Zimmer ist - doch eine Weile später sehe ich sie nicht mehr. Ich brauche einige Zeit, um herauszufinden, hinter welcher der vielen Türen des Anwesens der Eingang zum Château d'Hôtes ist. Eine junge Frau, die mich mit ihren langen schwarzen Haaren an die Tochter einer Freundin erinnert, führt mich durchs Foyer und zeigt mir mein Zimmer. Die Badewanne mit den Gründerzeit-Armaturen ist einfach unwiderstehlich - ich lasse mir ein Bad ein.
Wenigstens hier ist die Zeit stehen geblieben, irgendwo im 19. Jahrhundert - nach Napoleon, vor Bismark. Aber offensichtlich doch erst nach Erfindung der Ukulele. Natürlich gibt es elektrisch Licht... Und sekundenweise auch Wifi, um die Offline-Karten für die nächste Etappe nachzuladen. Leider reicht die Verbindung nicht aus, um die Navigation komplett vorzubereiten. |
Im Salon überlasse ich mich der nächsten Zeitreise. Ich stecke in einer Konversation mit Michel de Montaigne, er sagte eben: "Wenn die Leute mir vorwerfen, dass ich zu viel von mir spreche, so werfe ich ihnen vor, dass sie überhaupt nicht mehr über sich selber nachdenken." - Und was ist Nachdenken anderes als Sterben lernen! erwidere ich. Exactement! antwortet er - und ergänzt: Das muss ich mir für meine Essays merken. - Wir verstehen uns auf Anhieb. "Das Gespräch ist, meiner Ansicht nach, die lohnendste und natürlichste Übung unseres Geistes", sagt Montaigne nach einer längeren Denkpause. Das kommt darauf an, mit wem man das Gespräch führt, gebe ich zu bedenken. Bien, sagt er - und fragt mich dann, ob er ein Selfie mit mir machen darf.
Die Regale der Bibliothek sind voller alter Bücher, manche älter als das Schloss, in dem sie vor sich hinstauben. Nicht minder alte Gemälde suchen die Aufmerksamkeit des Betrachters - Protraits einstiger Bewohner, Szenen historischer Schlachten. Doch ich bin nicht in einem Museum, sondern in Räumen, in denen alles zum Inventar gehört, zur nutzbaren Ausstattung, zur zeitlosen Dekoration. |
Später am Abend kommen doch noch zwei weitere Gäste, ein deutsches Pärchen. Die beiden setzen sich zum Dinner an einen der Tische im Garten vor dem Schloss. Später kommen wir sehr anregend ins Gespräch - also ich und der Mann, seine schöne Reisebegleiterin hält sich weitgehend heraus, was die Unterhaltung erleichtert. Der Mann war schon öfters hier und erzählt mir von den Wochenend-Dinners, bei denen das Schloss voller stilvoll gekleideter Gäste ist. Auch ich bin heute Abend so stilvoll gekleidet, wie es ein Radwanderer nur kann - meine schwarze Cargohose passt überall. Bisweilen findet sich auch an meinem Tisch weibliche Gesellschaft ein - ab und an kommt die schöne Schwarzhaarige von der Rezeption und schenkt etwas Bordeaux nach, Wenn ich merci beaucoup sage, erwidert sie meine Französisch-Relikte mit noch charmanteren Floskeln.
Darüber hinaus, und davon weiß außer mir niemand, sitzt eine unsichtbare Frau an meinem Tisch - es ist meine himmlische Begleiterin, die Frau aus dem Weltall, die ich zum konspirativen Kartenstudium eingeladen habe. Wie gut, dass ich eine große Papierkarte von Elsass-Lothringen dabei habe, in die Frau Komoot einen analogen Bick werfen kann.
9. Etappe ![]()
Tarquimpol > Nancy > Saint-Maurice-sous-les-cotes
An diesem Morgen hat sich die Luft erstmals seit Beginn meiner Reise auf unter 20 Grad abgekühlt. Ich passiere das auf einer Halbinsel im großen Etang de Lindre gegründete Dörfchen Tarquimpol, ebenfalls ein Weiler am Weiher - ein durch ein Villarium umgebenes Villares. Durch die naturgegebene Begrenzung des Gehöfts konnte es sich nicht ausdehnen, wie es fast jeder menschlichen Ansiedlung im Laufe ihrer Geschichte beliebt. Aus der Entfernung von 100 Metern betrachtet wirkt die kleine Ansammlung von Häuschen wie ein Märchendorf auf mich. An der einstigen Römerstraße von Metz nach Strassbourg gelegen, muss der Ort in der Antike allerdings eine gewisse Bedeutung gehabt haben - in den 1980er Jahren wurden per Fotografien aus luftiger Höhe Strukturen bemerkt, die die Umrisse eines großen Amphitheaters erkennen liessen. Dem großen Radius der Anlage zufolge handelt es sich dabei um das größte Amphitheater Galliens, lese ich in der Wiki.
Meine himmlische Begleiterin kennt sich gut aus und dirigiert mich daher südlich von Brin-sur-Seille zu einem Radweg im Grünen, der durchs Tal der Amezule führt und daher auf den den schönen Namen Voie verte de la vallée de l'Amezule hört. Die Großstadt Nancy ist ein Verkehrsknotenpunkt, der für Freunde des Pedalierens eine Herausforderung darstellt - zum Glück streife ich nur den nördlichen Stadtrand, doch der ist dank seiner Industriegebiete, welche die Ufer der Moselle verunstalten, besonders hässlich.
Ein Stück weiter nördlich entspannt sich der Verkehr - der am Ufer der Moselle entlang führende Radweg ist nach Karl dem Kühnen benannt - Véloroute Charles le Téméraire. Kühn verlasse ich im Städtchen Pont-à-Mousson die Moselle westwärts. Ich überwinde einen etwa 200 Meter höher liegenden Gipfel und rolle dann dem Lac de Madine entgegen, welcher das größte Gewässer der Lothringschen Seenplatte und somit auch ein Magnet für Urlauber ist. Doch ich fahre gar nicht erst in den Ort und ans Ufer des Sees, sondern schwenke nach Nordwesten ab.
Im dörflichen Städtchen Saint-Maurice-sous-les-Côtes habe ich ein Zimmer gebucht. Nachdem ich mein Rad durch enge Gartentore in den Hof der Persion bugsiert habe, alle Reiseutensilien verstaut sind, der Schweiß des Tages dem Abfluss einer Dusche anvertraut ist, begebe ich mich in den Biergarten der Herberge, wo ich seiner Bestimmung nachkomme, indem ich ein Bier bestelle. |
Oh là là!
Die kleine Tochter der Wirtin kreist um den neuen Gast, der zufälligerweise seine Ukulele dabei hat. Ich spiele dem Kind Sur le Pont d'Avignon vor - am Ende des Liedchen sagt das Mädchen: encore! Natürlich soll das etwa fünfjährige Kind die geforderte Zugabe bekommen - ich greife erneut in die Saiten und singe Au Clair de la Lune. Das Mädchen fordert weitere Zugaben, entdeckt nebenher meine Hitech-Sänfte, blickt deren Besitzer an - und sagt: Oh là là!
Dann entdeckt das Mädchen eine Spielzeughupe, die ich ausschließlich zur Warnung schwerhöriger Passanten an meinem Rad angebracht habe. Sekunden später hat die Kleine den rosa leuchtenden Blasebalg von der Halterung abgezogen und überreicht ihn mir. Oh là là! kann ich da nur erwidern. Nach dem Bierchen spaziere ich durch den beschaulichen kleinen Ort mit dem etwas zu lang geratenem Namen. Im Zentrum gibt es kleine Lädchen und Denkmale. Einer Informationstafel entnehme ich, dass hier besonders der 1. Weltkrieg seine Spuren hinterließ - auf einem Friedhof stehen 1789 Gräber deutscher Soldaten. Schwer vorstellbar, dass ein so hübsches kleines französisches Kaff in die Verwüstungen eines Krieges gezogen werden konnte, an dessen Beginn nationalistische Konflikten auf dem fernen Balkan standen - der Übermut eines greisen Habsburger Monarchen, die verhängnissvolle Eigendynamik unseliger Militärbündnisse. | 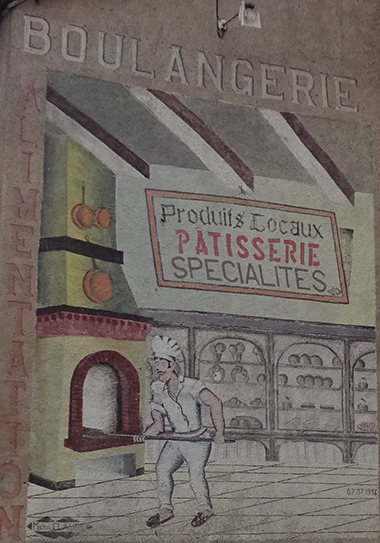 |
10. Etappe ![]()
Saint-Maurice-sous-les-cotes > Marville
Bei 13 Grad am Morgen hole ich dann noch mal das Jäckchen aus den Tiefen meiner Gepäcktaschen. Auf den Landstraßen, die in Frankreich von zahlreichen LKW-Fahrern genutzt werden, wahrscheinlich weil sie die Autobahnmaut sparen wollen, blicke ich mehr in die beiden Rückspiegel als nach vorn. Meistens kann ich zeitig erkennen, dass mich die LKWs wahrgenommen haben und in sicherem Abstand zu überholen beabsichtigen. Doch einmal fährt ein Laster sehr dicht auf - wie gedanklich schon mehrfach durchgespielt gehe ich in der vorletzten Sekunde auf Nummer sicher und weiche in den Straßengraben aus - zum Glück gibt es an dieser Stelle keine Leitplanken, die ein Ausweichen verunmöglichen würden!
Mein Rettungsmanöver wäre, im Nachhinein betrachtet, wohl nicht nötig gewesen, denn der LKW kam dann doch hinter mir zum Stehen. Aber bevor jemand meine Knochen unter den Achsen eines Lastwagens zusammensuchen muss, mache ich doch lieber freiwillig die Bekanntschaft mit dem Straßengraben. Es dauert ein Weilchen, bis ich die Dornen aus meinem Arm gezogen und meine Vorderräder wieder aufs Asphalt gebracht habe. Ich will so schnell wie möglich auf verkehrsarme Straßen oder Radweg kommen und schalte den elektrischen Hilfsmotors dazu auf eine höhere Unterstützungsstufe.
Schon Mitte Juli sehen die Felder aus wie sonst erst Ende August - die Dürre dieses Sommers ist außergewöhnlich. Auf einem Hügel nutze ich den kleinen Parkplatz, um den Abgasen der LKWs für eine Weile zu entkommen. Ein klappriger alter PKW knattert herbei und hält an - zwei der drei Insassen steigen aus um Fahrerwechsel zu machen, doch es gibt Probleme beim Anfahren - der Motor wird beim Anfahren jedes Mal abgewürgt. Es liegt offenbar an einem technischen Defekt - die Jungerwachsenen steigen aus, die Motorhaube wird geöffnet. Aus meiner Entfernung kann ich erkennen, dass etwas unter dem Boden herausbaumelt - also weise ich die Ahnungslosen darauf hin. Sie bedanken sich für meinen Hinweis, haben aber wohl weder Schraubenzieher noch technische Grundkenntnis an Bord. Stattdessen versuchen sie mit Vollgas und gleichzeitigem Anschieben anzufahren - und schaffen das nach einer Weile auch. Um der daraus resultierenden schwarzen Abgaswolke zu entfliehen, trete auch ich schnell wieder in die Pedale.
Zumindest der alte Traktor, den ich kurz vor meinem heutigen Etappenziel im Grünen entdecke, hat in den vergangenen Wochen keine all zu großen Umweltsünden begangen - außer den Boden und das Grundwasser mit entweichenden Diesel- und Ölresten zu verseuchen. Die ihn umrankenden, blühenden Pflanzen sind offenbar Oldtimer-Fans, sie stören sich nicht am Umweltfrevel der Menschheit. Sehr lange kann der Traktor noch nicht im Grünen stehen - sein Nummernschild sieht noch recht unverwittert aus - vielleicht wird er bald wieder flott gemacht.
Im ruhigen alten Städtchen Marville, nahe der Grenze zu Belgien, habe ich mein heutiges Etappenziel bereits erreicht. Da die Distanz nur halb so lang ist wie meine sonstigen Etappen, bin ich bereits mittags um eins nahe meiner Herberge. Ich habe viel Zeit, den Ort und die Umgebung zufuß zu erkunden. |
Die Nebenstraßen von Marville sind am Abend so ruhig, dass ein stehen gelassenes Spielzeugautos kein Aufsehen erregt. Mit dem grünen Cabrio dürfte schon der Urgroßvater gespielt haben. Als ich meine Kamera zu zücke, kommt ein Mann mit einer Flasche Rosé hinzu, amüsiert sich über mein fotografisches Interresse, posiert dann mit der Flasche vor dem Spielzeug, bis ich ihn bitte, auch mich einmal zu knipsen. |
Wenn schon Auto, dann wenigstens ein grünes Damit der fröhliche Mann zum Knipsen freie Hände hat, nehme ich ihm die schön gekühlte Flasche ab - und bewahre sie für ihn in meinen sicheren Händen auf... Fotografieren kann der gute Mann so erbärmlich gut wie etwa 99 Prozent der übrigen Menschheit, aber an seine Flasche Rosé erinnert er sich dafür um so besser - leider. |
Einem sonnigen Nachmittag folgt ein bewölkter Abend, der mir das Licht für reizvollere Fotokunst verweigert. An einem Straßentisch des Restaurants, das direkt am zentralen Platz vor der Saint-Nicolas-Kirche liegt, komme ich mit einem Deutschen ins Gespräch, der mit dem Rennrad von Frankfurt am Main nach Paris radelt - seine Tagesetappen sind entsprechend länger, sein sportlicher Ehrgeiz auf höherem Niveau. |
Wir reden übers Radeln, über französische Küche, französische Weine - Joachim schwärmt schon vom Champagner, in dessen Herkunftsprovince er morgen Abend sein Glässchen füllen lassen will. Wir sind gleichen Alters, aber an sehr verschiedenen Orten Deutschlands aufgewachsen - da kommt ein Gespräch unweigerlich kaum an diesen Verschiedenheiten vorbei. Nach vorsichtigen Umkreisungen einiger gesamtdeutscher Themen werden wir redseliger - der Wein lockert die Zungen. Weil es draußen kühl wird, gesellen wir uns in der Veranda zu den Fußballfans vor dem großen Fernseher - es spielt Kroatien gegen England. Ein alter Mann spricht mich an, für welche Mannschaft ich sei. Für die bessere antworte ich - darauf stößt der Franzose mit mir an. Dann verabschiede ich mich - aurevoir. Nichts gegen Fußball, aber ich möchte noch etwas durchs Städtchen zu bummeln - und meinen eigeenen, vom Wein berauschten Gedanken nachzuhängen.
Marville erinnert mich sehr an das mährische Slavonice, wo ich bei meiner Sommerradelei im Vorjahr zweimal zu Gast war - das von einer Blüte in der Renaissance geprägte Stadtbild ist vom Massentourimus verschont, die Straßen sind ruhig, nichts ist aufgemotzt - eine gewisse Unaufgeräumtheit, sei es Kinderspielzeug oder die Arbeitsgeräte und Baumaterialien an einem Haus, gehören zum ländlichen Charm. Ginge mir Französisch so locker von der Zunge wie Englisch, könnte ich mir gut vorstellen, hier zu leben - ich fühle mich hier sehr wohl.
11. Etappe ![]()
Marville > Sedan > Aubrives
Heute habe ich 150 Kilometer oder auch etwas mehr vor mir und deshalb bin ich sehr zeitig auf den Beinen. Doch die Reparatur einer Gepäcktaschenhalterung beschäftigt mich eine halbe Stunde. Und so bin ich doch erst gegen acht auf Achse. Bis Remilli-Allicourt geht es überwiegend auf Landstraßen entlang - zahlreiche LKWs erforderten wieder meine ganze Aufmerksamkeit. Dann quere ich erstmals La Meuse, jenen Fluss Fluss, den ich unter dem Namen Maas bisher nur aus dem Deutschlandlied kannte - von der Maas bis an die Memel wurde zu Fallerslebens Zeiten deutsch gesprochen, vom Etsch bis an den Belt.
In Lothringen bin ich auf mein sehr relikthaftes Französisch angewiesen. Ich gebe mir viel Mühe, wenigstens die Höflichkeitsfloskeln zu aktivieren - erfreulicherweise honorieren die Bürger der Grande Nation meine Versuche, ihre Sprache zu sprechen und lassen mir auch die eine oder andere angelsächsische Vokabel durchgehen. Die verkehrsreiche Stadt Sedan streife ich am südlichen Stadtrand, dann bleibe ich mal am linken mal am rechten Ufer der Maas, die sich nordwärts durch die Ardennen schlängelt.
Der Voie Verte Trans-Ardenne ist endlich mal ein ruhiger Flussradweg - und so grün, wie sein Name verspricht, ist die Landschaft auch - dichter Laubwald bedeckt die Berge zu beiden Ufern des Flusses. Hübsche kleine Ortschaften wie Monthermé besitzen Brücken, um die Ufer zu wechseln. Für einzelgängerische Subjekte wie mich haben aber besonders einzeln am Wege stehende Häuschen wie beim Dörfchen Deville große Anziehungskraft. |
Mein ursprüngliches Etappenziel
für heute wäre Hierges im nördlichsten Zipfel des französischen Maas-Tales gewesen. Doch die einzige Herberge des kleines Ortes wollte mir zwei Wochen vor Beginn meiner Reise keine Zusage machen - so lange vorher mache man keine Termine. Das mag seine Gründe haben. Also buchte ich via Booking.com ein Zimmer im nächsten Ort, in Aubrives. Dort haben sich daraufhin auch meine belgischen Freunde Herman und Leentje ein Zimmer reservieren lassen. Doch die beiden kommen mir noch ein Stück weiter entgegen - sie erwarten mich am rechten Maas-Ufer in Vireux-Wallerand. Es ist nach 20 Uhr - ich bin also bereits 12 Stunden unterwegs. Hunger habe ich nach ganztägigem Radeln eigentlich nie, aber der Besuch der Pizzeria ist bereits beschlossene Sache - und so dinniere ich nur flüssische Nahrung aus Hopfen und Malz.
Das idylische Örtchen Hierges am Fuße der gleichnamigen Burg erreichen wir erst in der Dämmerung. Das kleine Café und die kleine Bar sind an diesem Donnerstagabend bereits geschlossen - auch dieser Ort bleibt vom Tourismus verschont, zumal die Herberge, die von einem ansässigem Rentnerpärchen betrieben wird, auch gern mal auf "langfristig" planende Radler-Gäste verzichten kann... Wie schön wäre es gewesen, in diesem stillen Winkel noch einen Schoppen Traubensaft zu schlürfen. |
12. Etappe ![]()
Aubrives > Dinant > Namur > Brüssel
Freitag, der 13. Ich bin nicht abergläubig, obgleich ich in jungen Jahren in einen Verkehrsunfall verwickelt war, der auf einen solchen Freitag fiel. Die heutige Etappe ist zielführend, denn es geht nach Brüssel, zum Ziel der Reise. Das in der nächsten Maas-Schleife versteckte AKW lässt sich weiträumig umfahren, sofern ein Kilometer Abstand bis zu den Kühltürmen als weiträumig angesehen werden kann. |
Ich bin wieder zeitig in den Pedalen, denn bis Brüssel geht es durch den gesamten südlichen Teil Belgiens, das französisch-sprachige Wallonien. Ich folge dem linken Ufer der Maas, die sich durch felsige Landschaften windet, wie ich sie aus heimatlichen Gefilden kenne. Natürlichist mir auch der Anblick von Anglern vertraut, die zum ihrem Zeitvertreib besonders großen und besonders arglosen Flussbewohnern auflauern. |
 |
Am Ufer der Maas passiere ich die Stadt Dinant, die jeder Saxophonist kennen sollte. Denn Dinant ist die Heimat von Adolphe Sax, dem Erfinder des nach ihm benannten Blasinstruments. Kurz nach der Stadt folge ich den Fernradweg EuroVelo 5, der zwischen London und Rom quer durchs westliche Europa führt. Der heutige Streckenverlauf geht auf einen Erzbischof namens Sigerich aus der südenglischen Grafschaft Canterbury zurück, der ihn im Jahre 990 auf seinem Weg zum Papst beschrieb - daher hört der Pilgerpfad auch auf den zielführenden Namen Via Romea. Weil der Weg zu einem großen Teil durchs Frankenreich führte, erhielt er auch den Namen Frankenweg, er hört aber ebenso auf Via Francigena. |
Nach Namur verlasse ich das Flusstal der Maas - einige Anstiege sind zu bewältigen. Auf der Autobahn, die ich wenige Kilometer nördlich der wallonischen Haupstadt kreuze, hört erschrecke ich mal wieder über den motorisierten Auswuchs der modernen Zivilsation. Jedes dritte Fahrzeug ist ein LKW. Gäbe es nicht so viele Leute, die all den Kram kaufen, den die Laster transportieren, wären viel weniger auf den Straßen - die Welt wäre ruhiger, die Luft besser, es gäbe weniger Unfälle, weniger Krankheit, weniger Maloche, weniger Stau, weniger Frust, aber natürlich auch weniger Steuereinnahmen. Das aber darf nun gar nicht sein... |
Einige Kilometer weiter bin ich wieder auf dem Lande, doch die Sommer-Idylle trügt. Die Autobahn ist auch aus der Ferne zu hören, wenn man nicht selbst in einem Auto sitzt. Die Hitze des Nachmittags ist erbarmungslos, der Durst auf etwas anderes als über 30 Grad warmes Wasser wird immer stärker. Nahe des Dörfens Grand-Leez liegt das Château Petit-Leez, dem ich einen Besuch abstatte - genauer gesagt dem Gartenlokal. Die an einem der Tische sitzenden Männer sprechen mich schon beim Einparken auf mein ungewöhnliches Fahrzeug an: Ich beantworte alle Fragen, sobald ich ein kaltes Bier habe, erwidere ich auf englisch.
Das Schloss ist auch Domizil einer Gruppe Künstler, die ihre Dauerausstellung nach der Autobahn-Anschlussstelle "Exit 11" benannt haben - hier geht es also raus aus dem Wahnsinn? Ich lerne einen Maler kennen, der auf den schönen Namen Robert Quint hört. Ich frage ihn, ob das sein Künstlername sei. Nein, antwortet der aus Deutschland stammende Auswanderer, der fließend französisch und englisch spricht, mit mir deutsch - mit seiner finnischen Frau finnisch. |
Natürlich laden mich auch die anderen anwesenden Künstler zum Besuch der Ausstellung ein, doch ich bin, was zeitgenössische Kunst betrifft einigermaßen gesättigt - hier und jetzt möchte ich einfach nur meinen Durst stillen, den Schatten des Sonnenschirmes genießen, etwas ausruhen. Irgendwie beneide ich allerdings die hiesigen Künstler um ihr ländliches Domizil und um ihr nicht allzu besorgt wirkendes Leben. Hier lässt sich auf gepflegten Parkwegen flanieren und abends bei Wein und Tabak über den Sinn des Lebens sinnieren - die Stadt und alles Getöse der Zivilisation ist fern. Und wenn man doch mal schnell nach Brüssel oder Paris muss, der Exit 11 ist nicht nur einen Ausfahrt. Die Blechkarossen stehen startbereit im Garten.
Die alte Windmühle, die nur eine Ecke weiter auf den Namen Moulin Defrenne hört, wurde 1830 gebaut und 1990 so restauriert, dass sie seit dem wieder betrieben wird - bei Stromausfall vielleicht auch mal mit Windkraft... In der angeschlossenen Bäckerei wird das hier gemahlene Getreide zu Vollkornbrot verarbeitet, aber heute stehen alle Räder still und auch die Tür des kleinen Lädchens bleibt stumm und regungslos.
Ich nähere mich der belgischen Metropole Brüssel von Südosten und befinde mich bereits in Flandern, dem nördlichen Teil Belgiens, wo regionale Dialekte des Niederländischen gesprochen werden - als alter Germane verstehe ich etliche Wörter und kann mir denken, dass mit Groene Gurdel nichts anderes als der Grüne Gürtel gemeint ist, eine größere Wald- und Parklandschaft östlich der Hauptstadt. Das eigentliche Stadtgebiet streife ich marginal, denn meine belgischen Freunde wohnen nördlich des Grünen Gürtels.
Frau Komoot kann mich unter dem dichten Blätterdach nicht immer erkennen, daher kommen ihre Ansagen manchmal verzögert. Teils geht es über gepflasterte Waldwege, auf denen schon Schritttempo zu schnell sein kann. Sollte das der Pilgerweg des Erzbischoffs von Canterbury gewesen sein, dann ist hier vermutlich seit seiner Zeit, seit dem Jahre 990, kein Pflasterstein gerichtet worden. Aber wozu auch? Welcher Bischoff pilgert schon heute noch auf irdischen Wegen? |
Nur eine Startbahnlänge vom Brüsseler Flughafen entfernt erreiche ich Sterrebeck, stehe vor dem Haus meiner belgischen Freunde und bin damit am Ziel meiner Reise. Da Belgien die gleich Zeitzone hat wie Deutschland ist es in Brüssel eine Stunde länger hell als in Dresden, erst in der 11 Stunde dämmert es. Wir nutzen den lauen Abend und bummeln noch etwas durch den Brüsseler Vorort - im Visier liegt ein Eiscafé. Vor seinem Eingang liegen kreuz und quer die Fahrräder von Jugendlichen auf dem Weg - es scheint eine Mode zu sein, auf diese coole Weise zu parken. Das Pulikum ist multikulturell, man spricht niederländisch, französisch, englisch, aber auch deutsch. Ein Sportwagen kommt auf den Weg gefahren und parkt eben da - sein Fahrer legt die selbe Unbekümmertheit an den Tag wie die jugendlichen Zweiradler. Der Integrationshintergrund des PS-Machos ist nicht zu übersehen. Er (oder sein spendabler Herr Papa) hat also geschafft, wovon Millionen junger Zuwanderer noch träumen. Oder aber - inschallah - auch nicht mehr... Beim Ausparken und Wegfahren lässt er seine Motoren aufheulen - wahrscheinlich will er dem Rest der Welt demonstrieren, welche Stärke und Einmaligkeit er verkörpert.
Bei sich zuhause zeigt mir Herman die Tabulatur eines kleinen Werkes, das vor etwa 500 Jahren von Adrian Le Roy geschrieben wurde, natürlich für die damals üblichen kleinen Gitarren der Renaissance. Da Herman seit einem Weilchen Besitzer eines Zupfinstrumentes ist, das mit seiner Besaitung der Renaissance-Gitarre ähnelt und andererseits ein madeirischer Vorfahre der Ukulele ist, hat er das Werk so arrangiert, dass wir es gemeinsam spielen können. Die Idee ist also einigermaßen unorthodox.. Freitag, der 13. ist überstanden, ganz ohne Zwischenfälle.
In, bei und um Brüssel herum
Die französisch-sprachige Hautstadt mit dem großartigen Musikinstrumente-Museum hatte ich bei meinem ersten Belgien-Besuch im Jahre 2011 besichtigt, natürlich bin ich auch bei dem Brunnen mit dem berühmten Meneken Piss vorbeispaziert. Ich erinnere mich, wie wenig Aufregung diese touristische Attraktion bei einer Gruppe Kinder auslöste, die zusätzlich zum alles erklärenden Betreuungspersonal von einem singenden Lehrer bespaßt wurde - das volle Betreuungsprogramm für die nächte Touristen-Generation: Gruppen von Geführten, von Abhängigen, von Trotteln, die funktionieren...Das Gewühl der Hauptstädte ist mir schon seit längerem suspekt - Verkehrslärm, Hektik, Gedrängel, religiöse Fanatiker, die aus Langeweile Bomben explodieren lassen oder mit LKWs in Menschenmengen rasen. Museen, Konzerthallen, Restaurants, nichts ist mehr sicher vor all dem Wahnsinn des neuen Jahrhunderts. Der Standpunkt, man dürfe sich den Spaß nicht verderben lassen, weil der Terrorismus sein Ziel sonst erreicht habe, ist politisch korrektes Nachgeplapper, nur hört er deshalb leider trotzdem nicht auf. Also meide ich die Stadt, wo immer möglich, mein Musikfreund Herman hat bereits einige Ausflugsziele im ländlichen Umkreis der Hauptstadt im Plan.
Samstag. Nachdem ich Herman mit meiner himmlischen Freundin bekannt gemacht habe, nutzt auch er ihre gute Streckenkenntnis, um geeignete Radwege zu finden. Wir unternehmen nur eine kleine Radeltou in die Parks von Tervuren
Sonntag. Der Puls der Millionenmetropole ist auch am Stadtrand zu spüren - der Flughafen im Nordosten Brüssels ist ein Knotenpunkt der internationalen Luftfahrt. Von hier kann man ohne Umsteigen in die halbe Welt fliegen - zum Beispiel auf die portugiesische Atlantikinsel Madeira, wo die kleinen Zupfinstrumente, mit denen es Herman und ich zu tun haben, ihre Heimat oder Vorfahren haben und wo Herman bereits gastierte. Morgens um 7 dröhnen die Jumbos im 30-Sekunden-Takt über das Fenster der Dachstube, die für die nächsten Tage mein Quartier ist! Erfreulicherweise ist das Starten von wohl 100 Flugzeugen nach einer Stunde vorüber und ich kann noch einmal einschlafen.
Außer läppischen Brückenauffahrten gibt es in diesem flachen Teil der Welt für trainierte Radlerwaden keine Herausforderungen. Obgleich Brüssel und Umgebung noch 100 Kilometer von der Küste des Atlantik entfernt ist, gehört das Terrain bei einem Anstieg des Meeres um nur fünf Meter eigentlich schon dem Meer - es wird einen mächtigen Deich um Belgien, Holland, und die anderen flachen Küsten brauchen, damit Brüssel, Brügge, Antwerpen und Amsterdam nicht das Atlantis der Zukunt wird...
 | Am Wegesrand zweifelt ein seltam angebrachtes Fischernetz an sich selbst, weil es nicht weiß, was es eigentlich ist. Vielleicht ist es ein besonders originelles Kunstwerk, vielleicht aber auch nur ein etwas anderer Müllkorb ist. In jedem Fall macht es deutlich, was Leute unterwegs an Unmengen von Plastikmüll hinterlassen. Für wahre Gourmets kann das Ziel eines Sonntagsausflugs nur ein Eiscafé der Extraklasse sein. Der klassische Eisbecher ist hier ein klassischer Eisteller. Doch wenn man da nicht aufpasst, kann es passieren, dass es zum klassischen Erdbeer-Diebstahl kommt. Ich ertappe den Dieb und überführe ihn mit einem Foto vom Tathergang. |
Auf dem Rückweg überkommt mich wieder der Durst - in Weerde passiere ich ein Pub namens Schonzicht, das könnte so viel wie Schonzeit heißen. Im Hof stehen ein paar Tische, wo man gebannt in die Glotze starrt - endlich das letzte WM-Spiel: Kroatien gegen Frankreich. Ich habe den Eindruck, die Herzen der Zuschauer sind hier eher nicht bei den Franzosen - wir sind in Flandern... Ich empfinde den Aufenthalt zwischen den Einheimischen als sehr entspannte Schonzicht. Das erste Bier zischt nur in meinem Hals, das zweite hat eine Chance auf Genuss. |
Östlich der Brüsseler Flughafens unkreise ich einen Kreisverkehr - in dessen Mitte symbolisiert ein Kunstwerk aus Beton und Metall die tierische Lust am Fliegen, die wiederum auch sehr kindisch sein kann, wenn ich das vorne mitfliegende Mädchen richtig deute. Vielleicht verstehe ich auch alles ganz falsch und es handelt sich nur um eine Warnung für Graugänse, die dem Airport nicht zu nahe kommen sollen. |
Montag. Den größten Teil des Tages verbringe ich mit meiner Reise-Ukulele, einer flachen Ahorn-Brüko, und den Noten von Pimontoyse, so der Titel des kleinen Renaissance-Werkes, das mir Herman als Hausaufgabe gegeben hat. Unsere Intention ist, das knifflige Stück gemeinsam als Video aufzunehmen. Am Abend drehen wir eine kleine Runde zu einer der infrage kommenden Aufnahmeorte für unser Video. Die Kulisse, die Herman vorschlägt, ist eine künstlerische Installation am westlichen Ende des Parks van Terburen. Doch die hohen Bäume lassen kaum Licht durch, der Platz sagt mir entschieden nicht zu. Mein Favorit ist und bleibt das Spanische Haus am östlichen Ende des Parks. |
|
Dienstag. Am Vormittag üben wir noch etwas, dann radeln wir zu dem kleinen See vor dem Spans Huis, bauen unsere Stative auf - Leentje ist unsere Kamerafrau. Herman und ich streiten ein wenig über die günstigste Anordnung, werden uns aber einig. Nach einer Stunde haben wir die Aufnahme im Kasten. Es ist vollbracht. Zur Belohnung bestehe ich auf ein Braus am Spanischen Haus. Mit dieser Aufnahme ist allen Freunden der Ukulele einmal mehr gezeigt, dass der kleine Viersaiter auch in den ehrwürdigen Kreisen der Alten Musik mitspielen kann, wenn man ihn lässt. Ich denke, der Komponist, Adrian Le Roy, der selbst auch Sammler und Herausgeber vieler Werke seiner Zeit war, würde sich freuen, könnte er erleben, dass seine Musik noch ein halbes Jahrtausend nach seiner Zeit fortwirkt. Darauf trinke ich noch eine zweite Brause. |
 |
Das Praktische an einem Liegedreirad: Man muss den bequemen Liegestuhl nicht extra mitbringen... Das Instrument meines belgischen Musikfreundes hört auf den Namen Machete de Rajão, unter alten Bekannten auch einfach auf Rajão. Puristen der Alten Musik mögen sich an der unothodoxen Bestzung des Duetts stören. Ich aber fühle mich geehrt, diese musikalische Perle der Renaissance auf den vier Saiten meiner Ukulele begleiten zu dürfen.
13. Etappe
Brüssel > Leuven > Sint-Truiden > Maastricht
Landschaften fotografieren kann jeder - man muss nur zeitig aufstehen und hinausfahren. Genau darauf war ich eingestellt. In aller Frühe verlasse ich das Haus meiner Gastgeber. Das vorbereitete Frühstückspaket lüfte ich an einem ruhigen Ort auf dem Lande. Die Universitätsstadt Leuven erreiche ich zu einer Stunde, da standesbewusste Studenten sich noch mal umdrehen und weiterschlafen. |
Das Fotografieren schöner alter Fassaden ist schwierig, die Gebäude sind einfach zu hoch - und meistens auch schief... Immerhin fehlen zu dieser frühen Stunde noch die Blechlawinen, welche die alten Städte allerorten verunstalten. Die Geschäfte sind noch geschlossen, die Touristen sitzen noch in den Frühstückszimmern ihrer Hotels. Als ich Leuven vor einigen Jahren, auf meiner Tour nach Irland, besuchte, erlebte ich das komplette Gegenteil - am Abend gibt es keinen Meter, auf dem nicht der Stuhl eines Restaurants steht - Mangel an Leuten, die darauf sitzen wollen, herrscht nicht.
Es gibt zwar Radwege, doch die führen an der stark befahrenen Nationalstraße N3 entlang und sind zudem auch für Mopeds zugelassen. Der höhere Sinn dieser radlerunfreundlichen Gesetzgebung ist vermutlich, dass man die langsameren Fahrzeuge nicht auf der Straße haben will. Im Grunde sind die Radwege eigentlich Mopedwege, denn ich werde ständig von diesen Dreck- und Lärmschleudern überholt. Auf dem Weg liegt ein volles, ungeöffnetes Päckchen Pall Mall, wahrscheinlich ist sie einem Mopedfahrer aus der Tasche gerutscht. Im Liegedreirad kann man alles aufheben, ohne sich bücken zu müssen. Ich nehme die Schachtel an mich und beschließe, sie in der nächsten Stadt einem Bettler zu geben - die meisten rauchen ja.
Ich fahre durch Tienen, doch ich sehe keine Bettler, ich halte in Sint-Truiden, wieder keine Bettler. 7,40 Euro kostet das Päckchen laut der Preisangabe, dafür muss ein Bettler jenseits der Bettelmeilen gewiss ein ganzes Weilchen klappern. In der kleinen Stadt Borgloon, die sich wie eine Burg über die Eben erhebt, humpelt eine kranke Frau über die Straße und streckt den Passanten ihren leeren Kaffeebecher entgegen, sie bettelt ganz offensichtlich. Ich nähere mich ihr und reiche ihr die Schachtel. Aber sie ist überrascht, vielleicht von meinem Fahrzeug und davon, dass ich ihr statt Kleingeld eine ganze Schachtel Zigaretten anbiete. Sie stutzt noch immer: Keep it, smoke it, or sell it, sage ich zu ihr. Dann greift sie endlich zu.
Gegen vier erreiche ich im südlichsten Zipfel Hollands die Altstadt von Maastricht - und mein Hotel, das sich direkt gegenüber der Basilika des Heiligen Servatius befindet. Von meinem Zimmer habe ich den Blick über den Platz und zum Eingang der Schatkamer - dass diese kirchliche Zuschaustellung von Klunkern jeder Art viele Touristen anzieht, muss nicht erwähnt werden - in der Überzahl kommen weibliche Besucherinnen aus der Ausstellung. |
Die älteste Steinbrücke Hollands, die Sint Servaasbrug, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde, überspannt die Maas, deren Ufer ich bereits zwischen Sedan in Frankreich und Namur in Belgien ausgiebig beradelte. Die im 13. Jahrhundert erbaute Flussquerung blieb bis 1930 die einzige der Stadt und hörte daher schlicht auf den Namen "Brug" für Brücke. Erst nach dem Bau weiterer Brücken wurde sie nach einem der drei Eisheiligen, dem Heiligen Servatius, benannt.
Nach meinen ersten Eindrücken scheinen die Reiseberater jener Politiker, die hier einst den Vertrag von Maastricht unterzeichneten, gut gewusst zu haben, in welchen Winkeln des alten Europas das Flanieren, Dinieren und Verträgeschließen besonders angenehm ist. Ob der hier unterzeichnete Vertrag die Zerwürfnisse der EU überdauern oder nach einem Vierteljahrhundert obsolet geworden ist, werden die nächsten Jahre zeigen. |
Holland ist ein Fahrradland, das ist spätestens an einem der rammelvollen Fahrradparkplätze in der Maastrichter Altstadt zu bemerken, wo Hunderte geparkte Drahtesel darum bangen müssen, von ihren eigenen Besitzern abgeholt zu werden.
Wenn ich mir die dünnen Drahtseilschlösser ansehe, mit denen die meisten Räder "gesichert" wurden, ahne ich, dass ein geübeter Fahrraddieb hier nur einige Sekunden brauchte, um Beute zu machen - leicht und schnell.
Die unter auswärtigen Velopedalisten als Holland-Räder bekannten Zweiräder fallen dem Nicht-Holländer umgehend durch ihre geschwungenen Lenker auf, die eine aufrechte Sitzhaltung ermöglichen. Das sieht nicht nur bequem aus, es wirkt ausgesprochen elegant - sofern die städtischen Pendlerinnen in der dazu passende Kleidung stecken. Ich habe das Gefühl, dass ich hier vor 50 Jahren schon einmal war. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Phänomen namens Déjà-vu... |
Eine langhaarige Blondine weckt mich aus den nostalgischen Anwandlungen - vom Sessel eines Straßencafés an der Servatius-Brücke, habe ich einen vorzüglichen Blick auf das radlerische Treiben an diesem sonnigen Abend. Eine aufdringlische Bettlerin geht von Tisch zu Tisch und erzählt, sie brauche 10 Euro für ihr Bett in der Obdachlosenunterkunft. Sollte sie mit der Geschichte nur 10 Mal erfolgreich ist, dürfte sich ihr Abendspaziergang gelohnt haben. Ich versuche sie zu ignorieren, aber sie ist so aufdringlich, dass ich ihr sage, sie möge mich in Ruhe lassen. Das findet sie unhöflich und bleibt vor mir stehen, bis ich wirklich unhöflich reagiere. Ansonsten zeigt sich mir die Altstadt von Maastricht von ihren schönsten Seiten.
|
Ich staune, was für scharfe Fotos meine kleine Taschenkamera, eine Sony mit 10-fach Zoom, von den weit entfernten Spitzdächern hinter der Brücke schafft - leider laufen mir immer wieder Fußgängerinnen ins Bild - eine sogar noch mit einem schöneren Lächeln als jenem der berühmten Monalisa. Trotz der Entfernung von etwa 20 Metern scheint sie meinen voyeuristischen Blick erkannt zu haben - sie schaut mir direkt in die Augen, die Kleine, das Biest. Ihr Gang wirkt so grazil, sie könnte Mannequin sein - oder sie weiß einfach, was Männern gefällt. In der Vergrößerung des Fotos erkenne ich, dass sie blaue Augen hat - und ein güldenes Ringlein im linken Nasenflügel. Der Stummel einer selbstgedrehten Zigarette zwischen den Fingern ihrer rechten Hand zeigt, dass sie nicht ganz frei von Lastern ist.
Die wichtigste Nebensache der Welt ist Gruppen-Selfies zu machen und sich dann gemeinsam über das Gruppenfoto zu amüsieren. Auch in den Gassen von Maastricht beherrscht das Lieblingsspielzeug der Jugend das allgemeine Straßenbild. Neu ist mir, dass das Wischkastel auch bei den reiferen Semestern immer beliebter wird. Wohl dem Mann, der da ein verständig' Weib an seiner Seite hat. Viele der Senioren, die teils sogar aus dem Süden Europas anreisten, sind aber noch aus einem anderen, bedeutsamen Grund in die nach Maastricht gekommen...
Morgen Abend wird es auf dem großen Platz im Zentrum der Stadt ein einmaliges Ukulele-Konzert geben. Dann werden hier nicht nur jede Menge Senioren-Handys auf mich gerichtet sein. Aber will ich das wirklich? Vielleicht überlege ich es mir doch lieber anders, denn - so angenehm Maastricht auch auf mich wirkt - eigentlich möchte ich wieder hinaus ins Grüne und weiter radeln. Ich könnte die Mugge auch einem hier gebürtigen Geiger überlassen, der - wenn er viel Zeit hat - auf den Namen André Léon Marie Nicolas Rieu hört. Ich glaube, ich habe ihn schon so weit. |
Am Abend wird das Rot der Johannes-Kirche, bekannt auch als Sint-Janskerk, noch röter. Sie überragt alle anderen Dächer der Stadt und passt wegen ihrer Höhe auf keine Postkarte. Die tagsüber sich stauende Reisegruppen sind verschwunden. Ein betrunkener alter Mann sitzt schlafend auf einer Bank, wacht auf und versucht sein Fahrrad zu besteigen... Nach einigen Stürzen hat er es geschafft - und vertraut sein Schicksal der Straße an. |
![]() Röter als der Turm der Johannes-Kirche ist nur noch das Wappen der Stadt - wer bisher glaubte, der fünzackige Stern sei eine Erfindung der Freimaurer und späterer Weltverbesserer, kann in Maastricht lernen, dass der Druidenfuß schon längerer Tradition hat.
Röter als der Turm der Johannes-Kirche ist nur noch das Wappen der Stadt - wer bisher glaubte, der fünzackige Stern sei eine Erfindung der Freimaurer und späterer Weltverbesserer, kann in Maastricht lernen, dass der Druidenfuß schon längerer Tradition hat.
13. Etappe ![]()
Maastricht > Aachen > Monschau
Manchmal überfallen mich seltsame Träume, aber heute Nacht hatte ich einen völlig bescheuerten: Ich bin in irgendeinem größeren Betrieb beschäftigt - tatsächlich ist es über 30 Jahre her, dass ich überhaupt größere Betriebe von innen sah - das war zu DDR-Zeiten. Mir nichts, dir nichts werde ich in meinem Traum zu einer Art technischem Sicherheitsbeauftragten ernannt. Die Aufgabe scheint mir zu schmeicheln, jedenfalls lehne ich den Posten nicht ab - es ist ja auch immer irgendwo irgendwas im Argen, weil so viele Leute schlampig arbeiten, bis einem das Dach überm Kopf zusammenfällt... So weit, so gut. Doch plötzlich bin ich verantwortlich, wenn irgendwo was kracht. Das passiert dann auch prompt und daher muss ich schnell zum Ort der Katastrophe. Der Natur- und Umweltschutzbeauftragte in mir sagt aber: Nimm dein neues Liegefahrrad, es hat dich durch halb Europa gebracht, also ist es auch dein Dienstfahrzeug.
Selbstverständlich lasse ich es mir nicht nehmen, das Rad zu nehmen... Am Ort der Katastrophe treffe ich einen alten Freund, mit dem ich seit Ewigkeiten keinen Kontakt hatte. Noch bevor ich überhaupt Informationen über das Geschehen vor Ort bekomme, bevor ich erfahre, was eigentlich passiert sei, muss ich ihn fortschicken - natürlich aus Sicherheitsgründen. Und dann wache ich auf und frage mich, was der tiefere Sinn sein soll. Ich bin für mich - und zwar nur für mich selbst - verantwortlich, warum also sollte ich mir einen Posten wünschen, bei dem ich die Schlamperei von anderen in Ordnung zu bringen habe?
Die größte aller zivilisatorischen Katastrophen lässt sich auf dem American Cemetry erahnen, an dem ich pausieren muss, weil mich mal wieder die Elektronik meiner Hitech-Sänfte im Stich lässt. Hunderte von Gräberreihen ehren die US-Soldaten, die im Alten Europa ihr Leben ließen. Auf einer Wand können die Besucher die Frontlinien des 2. Weltkrieges studieren. Etliche der Kriegsschauplätze habe ich auf dieser Reise beradelt. |
Nach dem ich meinem Brüsseler Musikfreund Herman gesagt hatte, dass ich die Heimfahrt über Maastricht und durch den Naturparks Hohes Venn-Eifel in der Rureifel plane, zeigte er mir Bilder vom idyllischen Fachwerkstädtchen Monschau. Danach war für mich klar - und sollte es da auch von Touristen wimmeln, dass ich einen Abend in dem romantischen Kaff verbringen möchte. Tatsächlich hät sich der Andrang im Rahmen - als ich in der vierten Stunde eintreffe, bemerke ich jedenfalls weder geführte Gruppen noch sonstiges Gedrängel in den malerischen Gassen - vielleicht ist am Wochenende mehr los.
In der Auslage eines Souvenirladens entdecke ich eine Schirmmütze aus Seegras, wie ich sie bereits hatte, bis sich das Stroh eines Tages aufzulösen begann - da muss ich rein. Ich probiere und entscheide mich schnell. Dann kommt ein Grüppchen Kinder und die werden ganz und gar ihren Gender-Rollen gerecht. Die Mädchen umkreisen die Püppchen, die Jungs die Metallautos. Ich bewundere die Geduld der schon betagteren Verkäuferin - sie hat alles unter Kontrolle. |
Das Flüsschen Rur plätschert durchs hübsche Städtchen, die Brücken sind reizvoll mit Blumen geschmückt, schöne Frauen possieren vor Springbrunnen und anderen ihnen geeignet erscheinenden geeignetet Kulissen, Kellner pendeln zwischen ihrem Gasthaus und den Tischen auf dem Platz in der Stadtmitte. Hier gibt es Abendbrot, Abendwein, Postkarten und die Stimmung, altmodische Urlaubsgrüße zu schreiben. |
Das gern als Filmkulisse genutzte Städtchen ließ seit seiner Gründung im Mittelalter die verschiedensten Namensabwandlungen beziehungsweise Schreibweisen über sich ergehen. Vor genau 100 Jahren, im Sommer des letzten Weltkriegsjahres, hatte der letzte Kaiser des Deutschen Reiches offenbar nicht s Wichtiges zu tun... Jedenfalls ordnete er per Erlass die noch heute gültige Schreibweise Monschau an. Besonders märchenhaft, so habe ich mir sagen lassen, soll es hier sein, wenn zur Adventszeit Schnee liegt und wenn das Ortszentrum in einen Weihnachtmarkt verwandelt ist. Das mag sein, aber dann gäbe es hier statt eines gut ekühlten Weisweines klebrig-süßen Glühweinfusel - und damit könnte mich noch nicht einmal der Weihnachtsmann persönlich in Verlegenheit bringen. Nein, jede Zeit hat ihre Reize - für mich ist dieser warme Sommerabend zwischen Fachwerk und einem sanft rauschenden Bach im tiefen, tiefen Tal genau das, was ich unter Urlaub verstehe.
Die letzten beiden Stunden des Tages verbringe ich in meinem Zimmer vor der Flimmerkiste - im Ostalgie-Sender MDR läuft mal wieder
die Olsenbande. Beinharte Fans des dänischen Kinoklamauks behaupten, die ostdeutsche Synchronfassung sei viel witziger als die westdeutsche. Hat die Zensurbehörde der Honecker-Zeiten tatsächlich den Aufwand einer eigenen Synchronfassung veranlasst, damit diese harmlose Räuber-Pistole aus dem NSW* politisch-korrekt in die Hirne des sozialistischen Staatsvolkes gespült wird? Absolut komisch finde ich die Szene, als ein Polizeibeamter den Bahnangestellten nach dem Lehrling fragt, der die Weichen so stellt, dass für Egon Olsen alles nach Plan läuft - der Bahnangestellte beschreibt den Gauner-Nachwuchs der Olsenbande als langhaarig, bärtig und ungewaschen. Da ich von der Hitech-Duschkabine meines Zimmers reichlich Gebrauch machte, kann von mir zumindest Letzteres nicht behauptet werden. Die auf verschiedenen Ebenen seitlich eingebauten Sprühdüsen dürften hinläglich dafür gesorgt haben, dass keine Pure unterhalb meiner Halslinie unbespült blieb.
* NSW = Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet - so nannte die Obrigkeit der SED** den Teil der Welt, in dem der real existierend Kapitalismus versorgungstechnisch so effektiv funktionierte, dass ihn Leibeigene der Ulbricht-Honecker-Zone besser nur aus komischen Filmen kennen sollten...
** SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - konkurrenzloses Gleichschaltungsunternehmen
der Ulbricht-Honecker-Zone
14. Etappe ![]()
Monschau > Mechernich > Rheinbach > Bad Honneff > Unkel
Die junge Pensionsbetreiberin ist ostasiatischer Herkunft - vielleicht aus Thailand, Vietnam, Korea, egal. Sie schließt mir die winzige Fahrradgarage auf, deren Tür so eng ist, dass ich meine Sänfte nur seitlich gekippt heraustragen kann - dazu brauche ich Hilfe. Nach der gestrigen Abfahrt ins tiefe Tal des Städtchens Monschau weiß ich, dass die ersten Kilometer des heutigen Tages schwierig werden. Denn der Weg am Flüsschen Rur ist hier mit dem nicht passierbar. Zunächst geht es daher steil bergan - und wieder lässt mich der GoSwissDrive-Hilsmotor schon am halben Berg im Stich. Ohne Unterstützung habe ich aber selbst im ersten Gang keine Chance. Das Tretlagergetriebe der Marke Pinion untersetzt mit seinen 12 Gängen zwar stärker als als das 14-gängige Nabengetriebe von Rohloff, aber wenn man die Pedale quasi in den Himmel drücken muss, wird die Sache nicht leichter. Eher reißt die Kette, als dass ich ohne Assistenz vorwärts käme. Mithilfe der vor einer Woche erstmals getesteten Wäscheleine schiebe ich die gut 50 Kilo, die meine Sänfte samt Akkus und Gepäck wiegen dürfte, bergan.
Am Gipfel kann ich endlich aufatmen, doch eine Abfahrt mit 15 % Gefälle erfordert zumindest die gleiche Konzentration wie das Schieben eines Dreirades. Ich habe mir zwar mit Shimanos XT-Scheibenbremsen hochwertiges Material einbauen lassen, um in Sachen Talfahrt keine Kompromisse machen zu müssen. Aber kann man der Technik restlos trauen? Mehr als Schrittgeschwindigkeit riskiere ich nicht. |
Ein vollständige Entschädigung für die ersten Strapazen des Tages bieten die Radwege durch den Nationalpark Eifel. In einem der Täler an der Rur liegt das Dörfchen Hammer und das hat einen Campingplatz. Wie alle heutigen Campingplätze ist auch dieser überwiegend ein Parkplatz für Wohnmobile, aber ein paar Zelte sind am Flussufer auch noch zu sehen. Ob ein müdes Radlerhaupt hier Ruhe finden kann, weiß man nicht. |
An der Rurtalsperre geht es gelegentlich noch über einige Hügel, aber daran nimmt mein GoSwissDrive-Assistent keinen Anstoß. Bis zum Rhein halte ich m,ich ostwärts und durchfahre Dörfer und Städtchen, deren Namen ich noch nie gehört habe: Mechernich, Rheinbach, Meckenheim. Bei Bad Honnef bringt mich eine Fähre ans östliche Ufer - die folgende Strecke ist mir bereits von meiner Herbstradelei im Vorjahr bekannt. Übersehen habe ich damals allerdings einen Biergarten wenige Koilmeter nördlich von Unkel. Da ich im Herbst von Unkel aus nordwärts nach Köln aufbrach, wäre der Biergarten ohnehin noch geschlossen und tabu gewesen. Doch diesmal passt es gut, zumal gerade ein Gewitter aufzieht. Wahrscheinlich könnte ich es noch bis zu meinem Quartier Unkel schaffen, ohne nass zu werden, aber hier finde ich auch ein schützendes Dach. Ganz besonders aber reizt mich das Speiseangebot - Flammkuchen hatte ich jetzt schon 10 Tage nicht mehr. Das kühlende Hopfengetränkmacht zusätzlich Appetit.
In Unkel kehre ich wieder im selben Gasthaus im Vorjahr ein, die Wirtin erkennt mich aber nicht - sie hat viel zu viel mit den Gästen zu tun, die im Gartenrestaurant dinieren. Erst als alle Gäste fort sind, ist Gelegenheit für einen Schwatz. War hier damals, als Willi Brandt hier wohnte und Kohl und Gorbatschow zu Besuch kamen, eine Hochsicherheitszone, frage ich sie. Nein, davon hat man gar nicht viel mitbekommen, weil Brandts Wohnhaus im südlichen Teil von Unkel lag. |
Von Unkel nach Runkel?
Von Unkel nach Runkel, so lautet mein heutiges Tagesmotto. Ich will den Rhein herunter bis Koblenz und dann an der Mündung der Lahn dem Lahn-Radweg folgen. Da es in Runkel kein Zimmer gibt, habe ich mir schon ein Zimmer in Weilburg reserviert - das ist gut 150 Kilometer entfernt, ziemlich weit. Aber ich bin früh auf den Beinen - die Wirtin hat das Frühstück für mich extra schon um sieben serviert. Halb acht sitze ich in meiner Sänfte und will starten. Doch manchmal kommt es anders und das auch noch völlig anders als man denkt...
Gleich nach dem Einschalten des Assistenzsystems wird eine Fehlermedlung angezeigt: M64, sofern ich das in der Kürze der Anzeige richtig erkannt habe. Ich schalte aus und erneut ein - da wird M54 angezeigt. Ich bin noch keinen Meter gefahren! Die Luft ist morgenfrisch, Überhitzung ist definitv nicht der Grund für das Problem. Erstmal ohne Unterstützung losfahren, vielleicht gibt sich das Problem - die Hoffnung stirbt zuletzt, mal wieder. In Linz an der Fähre treffe ich einen Fernradler, der sich für mein Gefährt interessiert. Ich erzähle ihm von dem Problem, dass ich gerade habe. Der junge Mann erzählt mir, dass er nach Schottland radeln will... Genau, das wäre auch mein Plan für nächstes Jahr... Aber ist das mit dieser fragilen Technik überhaupt noch möglich?
Von der Fähre fällt der Blick über den Rhein, der morgendliche Himmel ist noch grau. Im Norden erhebt sich das Siebengebirge mit dem Drachenfellsen. Doch die meine Stimmung ist getrübt. Wie soll es jetzt weitergehen! Am anderen Ufer, in Krippen, starte ich das System erneut, es dauert ein paar Sekunden länger, bis die Fehlermeldung M54 wieder auftaucht. Endlich ist klar, dass ich zumindest hier und heute nicht weiterkomme - ich habe das Assistenzsystem mehr als 50 Mal gestartet und immer folgte die gleiche Meldung. Es ist inzwischen um neun - ich werde wohl den extra für solche Fälle bei der Ammerländer Versicherung abgeschlossenen Roland-Schutzbrief der in Anspruch nehmen müssen.
Contenance bewahren
Was ich mit einem Sachbearbeiter vom Roland-Schutzbrief in den folgenden vier bis fünf Stunden erlebe, ist eine Posse sondersgleichen. Es macht Arbeit, aber ich muss sie erzählen: Nach einer Stunde des Nichtstuns hält ein Herr namens Hänzschel es bereits für einen großen Erfolg herausgefunden zu haben, dass ich in Krippen am Rhein sei - und nicht in Remagen, wie es ihm sein Kollege übermittelt hatte, der die Schadensmeldung als erster annahm. Nach einer weiteren Stunden schlägt man mir vor, dass ich doch mal an einem Radladen vorbeifahren könnte, der mir dann weiterhelfen könne.
Ich kläre Herrn Hänzschel auf, dass die spezielle Technik meines Liegedreirades nur von einem Vertragshändler geprüft und im Falle eines ernsten Problems nur vom Hersteller repariert werden kann. Daraufhin versucht er sich schlauzumachen, googelt wahrscheinlich etwas herum, ruft eine weitere Stunde später an, mir zu erklären, was ich ihm bereits erklärt hatte. Der Mann schwärmt geradezu über seinen kenntnisgewinn - der Höflichkeit halber unterbreche ich nicht gern jemand im Redefluss, aber hier bin ich gezwungen. Dann schlägt er vor, zum nächsten Bahnhof würde ich es gewiss irgendwie schaffen und dann könne ich ja mit der Bahn weiterfahren...
Obgleich der Mann von Roland mir vorhin noch erklärt hat, was für ein außergewöhnliches Fahrrad ich habe, kann er sich jetzt nicht vorstellen, dass sich selbiges nicht einfach unter den Arm klemmen und über Bahnhofstreppen tragen lässt, dass selbst die Aufzüge zu klein sind. Und dass man bereits für ein normales Fahrrad eine Platzreservierung braucht, die von heute auf morgen zu erhalten in der Urlaubshochsaison eine Illusion ist, weiß der Mann sicher auch nicht. Herr Hänzschel erweißt sich schon jetzt als so inkompetent, dass man keine Steigerung erwarten kann, doch es kommt noch schlimmer.
Ich muss eine weitere Stunde warten, bis Hänzschel sich wieder meldet. Er schlägt vor, ich könnte einen Transporter mieten, wenn ich einen Fürherschein hätte. Habe ich, aber nicht dabei. Na, das ginge vielleicht auch ohne Papiere, meint Hänzschel, er melde sich dann wieder. Es scheint dem Selbstschutz der Roland-Sachbearbeiter zu dienen, dass sie nimmer mit unterdückter Nummer anrufen, mann kann sie also nicht zurückrufen! Es vergeht eine weitere Stunde, zum Glück ist ein Imbisstand an der Fähre, wo ich mr die Zeit mit einem Becher Kaffee verkürzen kann. Gelegentlich werde ich auch von Radlern angesprochen - dem ersten erzähle ich noch die ganze Geschichte, dann übe ich mich in der Kunst der Kurzfassung.
Es ist inzwischen nach zwölf Uhr - da sich Hänzschel seit über einer Stunde nicht zurückmeldet hat, rufe ich erneut die Service-Nummer an, muss mir wieder das grauenhafte Gedudel der Warteschleife anhören, dann einem anderen Sachbearbeiter die Kurzfassung schildern. Schon das ist ist so nervend und kostet enorm viel Selbstbeherrschung. Ich möchte nicht unhöflich werden - die Leute, die da am Samstagmittag an den Telefonen sitzen, sind nicht zu beneiden. Aber ich deute wenigstens an, dass mir bald der Kragen platzt. Und es kommt noch schlimmer!
Als Hänzschel wieder anruft, teilt er mir mit, er habe mit seinem Kollegen nach Lösungen gesucht - ich erinnere mich nicht, wie er es genau formuliert hat, aber was er gemeint hat ist, man sei gerade am Ende mit dem Latein. Nun müsse ich auch mal selbst etwas Initiative zeigen! Ich versuche mich zu beherrschen: Alexander, bleib jetzt ganz ruhig, ommmmmmm... Du hast dir von diesem Trottel bereits drei Stunden deines stehlen lassen - jetzt einfach Arschloch zu ihm sagen und auflegen ist auch keine Lösung. Es geht nun darum eine Unterstellmöglichkeit für mein Rad zu finden. In den Hotels vor Ort bräuchte ich nicht mehr anzufragen, das habe man bereits versucht.
Ich gehe die Straße entlang, um zu sehen, ob es Garagen oder Werkstätten zum Unterstellen gibt. Ich rufe einen Freund an, der etwa 75 Kilometer entfernt wohnt. Morgen, sagt er, da könne er helfen. Aber ich sitze jetzt in der Patsche. Hänzschel ruft an, teilt mir plötzlich mit, ich könne das Rad in dem Hotel untertsellen, vor dem ich stehen würde... Woher will er wissen, vor welchem Hotel ich stehe, es gibt hier einige nebeneinander! Und hat er nicht vor nur zehn Minuten gesagt, in den Hotels der Umgebung bräuchte ich es gar nicht versuchen!
Und nicht weglaufen!
Egal. Ich greife diesen ersten Strohhalm, der Chef vom Rhein Inn ist sehr freundlich, zeigt mir den Platz in seiner Garage, wo ich das Rad anschließen kann. Ich brauche ein Weilchen zum Umpacken, denn ich kann nicht beide Fahrradtaschen und das Zelt schleppen, wenn ich mit der Bahn heimfahre. Vor fünf Minuten sagte Hänzschel, das Taxi zum Bahnhof sei schon bestellt, ich solle daher warten "und nicht weglaufen..." Jetzt ruft er an und sagt, ich könne das Taxi zum Bahnhof auch selbst bestellen. Also ist es doch nicht bestellt? Darf ich doch "weglaufen"?
Irgendwie hat es schon groteske Züge, wenn man vom Sachbearbeiter einer Versicherungsagentur die telefonische Ansage bekommt: "Und nicht weglaufen!" Ich meine, wenn ein Mann ein paar Jahre verheiratet ist, mag er sich vielleicht daran gewöhnt haben, dass ihm jemand sagt: Nicht weglaufen! Aber wenn man sich die Unabhängigkeit bewahren konnte und beinhart auf die 60 zuradelt, fühlt man sich doch sehr in Zeiten versetzt, wo das Nicht-Weglaufen! administrativ geregelt und mit Stacheldraht und Mauer zementiert wurde. Nicht weglaufen... Ich fass' es nicht!
Eisenbahn fahrn...
Wie froh kann ich sei, dass auch ich seit einem Jahr zu den Besitzern jener kleinen Wunderwerke namens Smartphone gehöre - es hilft mir Radwege zu finden und ihnen zu folgen, unterwegs Unterkünfte zu finden und zu buchen - und die Applikation der Deutschen Bahn findet in Nullkommanichts eine passende Zugverbindung für mich. Weil die App meinen Standort kennt, ermittelt sie als nächsten Bahnhof den von Linz - am anderen Rheinufer. Gut, dann brauche ich allerdings das Taxi gar nicht - um mit der Fähre ans andere Ufer zu gelangen, muss ich nicht in einem Taxi sitzen... Nicht einmal das hat der Herr Hänzschel vom Roland-Schutzbrief geprüft - er macht seiner Firma also eigentlich mehr Kosten als nötig und wahrscheinlich kriegt das in den kollektiven VEB -Hierarchien solcher Versicherungskombinate auch niemand mit.
Zwar sind es bis zum Bahhof noch 500 Meter Fußweg, aber das sollte trotz der unhandlich zu tragenden Radtaschen zu bewältigen sein. Während ich zu dieser Einsicht komme, ist das Taxi auch schon. Ich zahle dem Fahrer die Anfahrtskosten von fünf Euro und spare der Versicherung die Übernahme weiter Kosten... Mit der Bahn-App erwerbe ich auch das Online-Ticket - moderne Technik ist eine feine Sache, so lange sie funktioniert. |
Wie zeige ich dem Schaffner eigentlich mein Online-Ticket, wenn mein Handy nicht genügend Saft hat oder aus anderen Gründen nicht funktioniert? Oder wenn es mir ein Dieb entreißt - im Zug lungern einige jugendliche Gestalten herum, denen ich alles zutraue. Nach all den schrecklichen Vorfällen der letzten Jahre habe ich jeden Grund, insbesondere männlichen Migranten zu misstrauen - zu viele dieser jungen Männer sind durch ihre abenteuerliche Zuwanderung kulturell und sozial entwurzelt, die Salafisten Kölns warten genau auf solche Entwurzelten. Habe ich Ressentiments?
Ja, selbstvertsändlich habe ich nach all den schrecklichen Nachrichten der letzten Jahre Abneigungen. Am Ende meiner vorjährigen Herbstradelei liefen mir in Köln zwei junge Männer mit langen Bärten in orientalischer Kleidung über den Weg - dem Äußeren nach reinste Bilderbuch-Salafisten. Warum soll ich junge Männer sympathisch finden, die in Deutschland die Scharia einführen wollen? Ich hatte nicht die Absicht, diese vom Islam unterwanderte Rhein-Metropole erneut zu besuchen - doch nun bin ich auf dem direkten Weg dahin.
An einer der Stationen der Regionalbahn nach Köln steigen sieben fremdsprachige Nonnen ein - mohamedanische Kopftuchfrauen treffen auf katholische Kopftuchfrauen, einige in grauen, die anderen in hellblauen Gewändern... Hat der liebe Gott sie zu meinem Schutz geschickt oder eher umgekehrt? Also mich zu ihrem Schutz? Sind die Nonnen ein attraktives Angriffsziel? Hat der müde wirkende junge Migrant eine Bombe im Rucksack? Oder nur eine Axt? Oder ein Messer?
Die zugestiegenen deutsch-sprachigen Fahrgäste wirken gelassen - sie sind das multi-religiöse Mileu gewöhnt, sie haben sich damit abgefunden oder halten sich für Kosmopoliten. Während ich die Reisenden beobachte und mir meine Gedanken machen, wohin die Reise Deutschlands geht, ruft mich nochmals Herr Hänzschel an - es ist um drei. Er will wissen, ob er "jetzt Feierabend machen kann"... Der Mann hat Glück, dass ich nach all dem Verduss wieder entspannter drauf bin und meinen Humor zurückfinde, doch im Grunde sagt er mir mit der Frage nichts anderes als dass ich ihm den ganzen Tag für Beschäftigung gesorgt hätte. Eigentlich könnte er froh sein, dass er keine Langeweile hatte - es gibt gewiss schlimmere Beschäftigungsverhältnisse - ich drücke das so umständlich aus, weil ich den hehren Begriff Arbeit möchte nicht herabwürdigen möchte.
Befehl zur Treue
Die Umstiegszeit in Köln ist planmäßig nur sieben Minuten - Verspätung und ohne Fahrrad als Gepäck reicht das auch. Der Zug nach Frankfurth am Main rollt an den Türmen des Kölner Doms entlang und dann auf die Bahn- und Fußgängerbrücke über den Rhein - im Oktober letzten Jahres schlenderte ich über die Brücke und staunte über geschätzt hunderttausend Vorhängeschlösser, welche Verliebte am Geländer des Fußweges nahezu lückenlos angeschlossen haben. "Der Befehl zur Treue, den die Gesellschaft erteilt, ist Mittel zur Unfreiheit", soweit kann ich dem Autor des Suhrkamp-Taschenbuches, das ich als Reiselektüre dabei habe, folgen. Was mag der Verfasser der Minma Moralia zum Zeitpunkt des Gedankens, im Jahre 1951, mit dem Nachsatz "aber nur durch Treue vollbringt Freiheit Insubordination gegen den Befehl der Gesellschaft" wohl gemeint haben? Was ist Freuheit? Was Treue? Zu wem oder was?
Im ICE nach Frankfurt am Main finde ich immerhin einen Sitzplatz. In der Reihe hinter mir singt ein kleines Mädchen englisch-sprachige Popsongs und auch mit ihrer Mutter spricht sie akzentfreies Englisch. In Frankfuth habe ich fast eine Stunde Aufenthalt - zu viel um auf dem Bahnhof abzuhängen, zu wenig um spazieren zu gehen. Als ich das letzte Mal hier umstieg, wurde ich von Bettlern belagert.
Die Bahnhofsdurchsagen sind schlecht verständlich, viel zu laut ist das Quietschen der Bremsen einfahrender Zügen und das Geplapper der austeigenden Menschenmassen. Mit dem Fernglas kann ich die Anzeigetafel lesen und dann die alte Frau neben mir beruhigen, dass unser Zug wie vorgesehen auf diesem Bahnsteig abfährt. Und das tut er dann auch. Da ich gleich in einem Abteil neben dem Bordbistro einen Sitzplatz gefunden habe, ist die Versuchung groß. Ich weiß, dass ich ihr den vier Stunden planmäßiger Fahrzeit ohnehin nicht wiederstehen kann, also versuche ich es gar nicht erst.
Nach Oschatz bleibt der ICE mitten auf der Strecke stehen: Böschungsbrand, erläutert der Schaffner. Als es nach einer guten halben Stunde weitergeht, passiert der Zug die noch immer stark rauchende Brandstelle, jede Menge Feuerwehrleute sind noch vor Ort, letzte Glutnester werden gelöscht. Der Rauch dringt auch in den Zug, verflüchtigt sich aber bald wieder, als der Zug Fahrt aufnimmt. Infolge der Summierung weiterer Verspätungen komme ich etwa eine Stunde nach fahrplanmäißger Ankunftszeit in Dresden an, steige auf dem Hauptbahnhof in die S-Bahn, die mich dann hoffentlich ohne Zwischenfälle nach nach Niedersedlitz bringt, von wo ich die Straßenbahn nach Laubegast nehmen kann.
|
|
An der ersten Haltestelle wird die Bahn voll. Mit ihren schwarzen Locken und dem Stirnband erinnert mich eine der Frauen an Filme, in denen Seeräuber in karibischen Hafenbars absteigen. |
Ich bin wieder zuhause. Meine Sänfte steht in einer Garage am Rhein - so hatte ich mir die zweite Hälfte meine Urlaubs eigentlich nicht vorgestellt. So gern wäre ich durch die Täler der Lahn geradelt, über den Rennsteig-Radweg und über die Höhen des Ergebirges.
Bilanz
Eine Tour wie die beschriebene würde auf herkömmliche Weise kiloweise Kartenmaterial erfordern. Ich bin vielleicht ein bisschen altmodisch oder noch etwas misstrauisch gegen die Omnipräsenz der digitalen Gerätschaften. Tatsächlich hatte ich viele Karten im Gepäck, doch die reichen bei weitem nicht, um die gesamte Strecke abzudecken. Mittels des Radwegplaners von Frau Komoot ![]() konnte ich meine Etappen am Computer detailliert planen und mich navigieren lassen. Vom Winde zerfledderte, vom Regen aufgeweichte Karten gehören der Vergangenheit an. Jetzt gilt es, auf den Ladezustand des Handys zu achten.
konnte ich meine Etappen am Computer detailliert planen und mich navigieren lassen. Vom Winde zerfledderte, vom Regen aufgeweichte Karten gehören der Vergangenheit an. Jetzt gilt es, auf den Ladezustand des Handys zu achten.
Auf den etwa 2000 Kilometern meiner Reise begegnete mir nicht ein einziges Mal ein ähnliches Fahrrad, noch nicht einmal einem herkömmlichen Liegezweirad. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit, die meiner Sänfte entgegengebracht wurde. Kinder, von Natur aus neugierig, winkten mir fröhlich zu. Aber auch die Anhänger dröhnender Motorräder grüßten allenthalben. Dabei sind letztere, insbesondere wenn sie in Gruppen unterwegs sind, quasi die natürlichen Feinde der selbstkurbelnden Spezies. Ich staune, dass es so wenige Dreiradler gibt, denn die Bequemlichkeit des Liegedreirade ist unübertrefflich.
Wenn an hochkomplexen technischen Geräten etwas klemmt, braucht es professionelle Pannenhilfe - die hatte ich mir durch eine Vollkaskoversicherung mit Roland-Schutzbrief erhofft. Leider war das Gegenteil der Fall. Es kam noch nicht mal jemand vor Ort - und die telefonische "Betreuung" von ca. fünf Stunden war eine Katastrophe. Als das Rad 10 Tage später beim Vertragshändler in Radebeul ankam, war es nahezu schrottreif - die von der Versicherung beauftragte Spedition hatte zuvor vermutlich noch nie Fahrräder transportiert. Wahrscheinlich leistet ein Gabelstapler ganze Arbeit, in dem er noch ein bisschen nachschob...
Nun hatte ich einen doppeltden Schaden - einen Garantierfall plus einen Schaden durch die Unfähigkeit der Versicherung, einen zuverlässigen Spediteur zu beauftragen. Es hat am Ende elf (!) Wochen gedauert, bis ich mein Rad repariert abholen konnte! Der ganze Sommer war damit im Eimer. Die Versicherung antwortete nicht auf meine Beschwerden. Der Hersteller reparierte entweder nicht alle Schäden vollständig oder es kamen beim Transport neue Schäden hinzu, auf wessen Konto am Ende was geht, ist leider kaum nachweisbar.